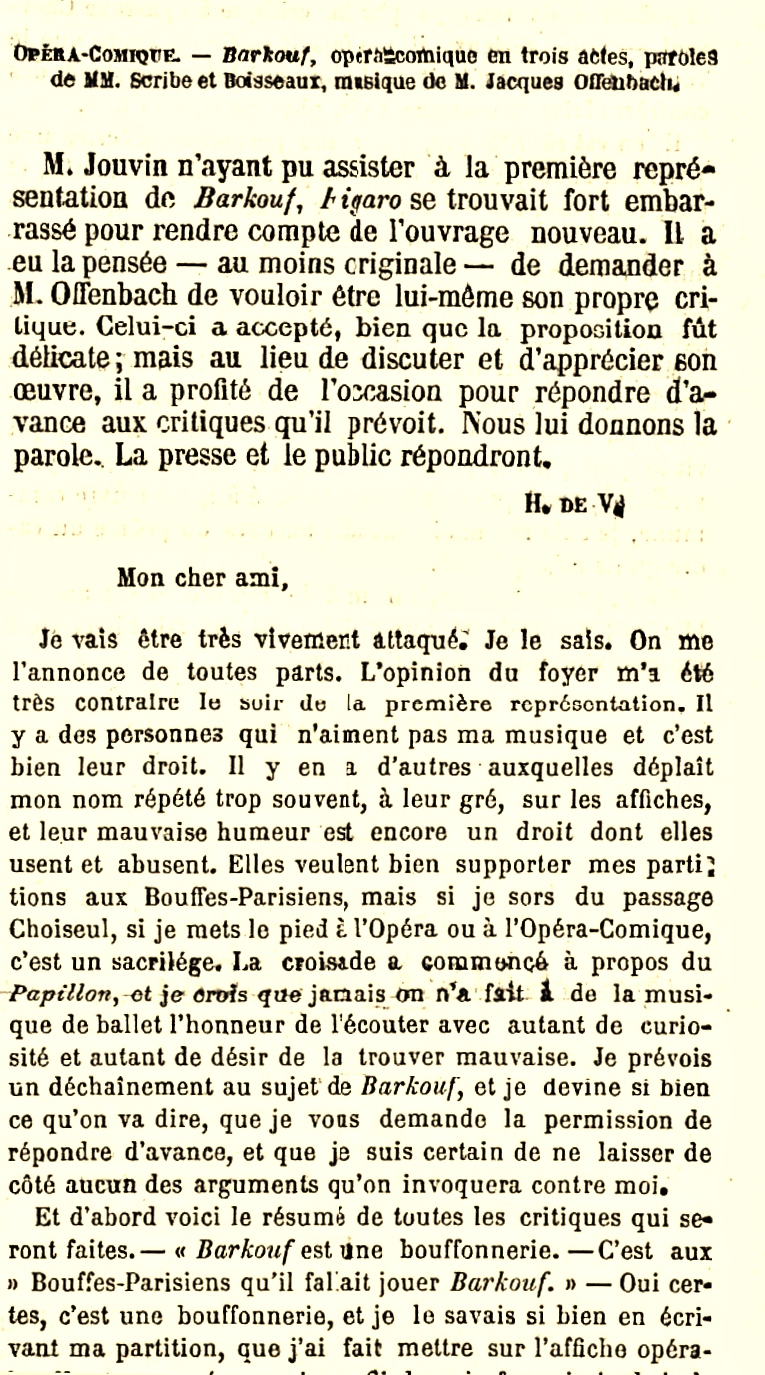Hannover 1690: Der Gelehrte und die Herzogin
Sie ist wirklich der einzige Mensch, auf den er sich gefreut hat, als er zurückkam, wohin er nicht zurückkommen wollte. Gut, er hätte in Rom bleiben können, um dort die Vatikanische Bibliothek zu leiten, der neue Papst bot ihm das an. Aber konvertieren, wenn die katholische Glaubenslehre weiterhin die Sonne um die Erde kreisen lässt? Als Wissenschaftler, im Jahre 1690? In Wien wäre er auch gern geblieben, in kaiserliche Dienste getreten, daraus wurde nichts, trotz der Audienz, er sah da förmlich, wie Leopold I. innerlich gähnte, als er ihm darlegte, was man alles reformieren könnte.
Also nach zweieinhalb Jahren Reise wieder hinauf in den Norden, in dieses Nest beschränkter Köpfe, in einer flachen, unspektakulären Landschaft. Hannover ist zehn Mal so klein wie Wien, aber mit einem Herzog, der hoch hinaus will. Sonst hätte er ihm die Reise nicht bezahlt, der Welfe, der versessen auf die Kurwürde ist und seinen Hofrat losschickte, um in europäischen Bibliotheken Dokumente zu sammeln. Es soll belegt werden, zugespitzt gesagt, dass die Welfen praktisch schon bei der Gründung Roms dabei waren. Tausende von Kilometern mit einem Schnitt von 40 Kilometern am Tag, schneller geht es nicht auf den zwei schmalen Bändern aus Steinen, die man Landstraßen nennt. Keine Federung zwischen Achse und Karosse. Die letzten Meilen, bis von Süden das Ägidientor erreicht war, haben geschmerzt.
Was ihm die Rückkehr leichter machte, war Sophies letzter Brief, noch von Ende Februar, „A Monsieur de Leibenitz à Modene“. Sie hatte sich über seine Neujahrswünsche mehr gefreut als über alles, was ihr Könige und Fürsten schickten, und hoffte ihn wiederzusehen, solange ihr Mann mit dem Heer unterwegs war. Etwas hatte ihn erschrocken in dem Brief, was er doch längst wusste, „Vostre bibliotheque cet convertie en theatre“. Sie haben ein ganzes Opernhaus angebaut ans Schloss, und die Hofbibliothek samt Hofrat in der Leinstraße gleich gegenüber untergebracht, zwei Stuben und ein Saal mit mehreren 10.000 Bänden. Da wohnt er nun seit einigen Wochen.
Er kann der Herrschaft jetzt also direkt in die Fenster sehen. Nicht nötig. Er wird Sophie gleich selbst treffen an diesem Julisonnabend, sie ist vorausgefahren nach Häringhusen, wie das mal hieß, ehe die Herzogin dort ihr kleines Versailles einrichtete. Nur ein kleines Versailles? Allein der französische Garten soll mit 50 Hektar so groß werden wie die ganze Altstadt hier. Und während in der Residenz alles nach der französischen Mode geht, nach der Musik, zu der Louis Quatorze tanzt, und nach den Kleidern, die seine mächtige Mätresse trägt, die Martinon, ufert der Krieg aus, den er begann. Der Hofrat faltet auf der kurzen Fahrt die Zeitungen auseinander. Der Norddeutsche Mercurius weiß von einer Seeschlacht, zu der die französische Flotte auslief, Ausgang jetzt unklar, obwohl die Schlacht schon zehn Tage zurückliegt. Dass 15.000 Männer das Leben verloren haben und Frankreich sich einen Sieg auf die Fahnen schreiben kann, wird Leibniz erst später lesen können.
Ihre Allerhöchste Durchlaucht ist nicht allein, als er in ihre Gemächer in Herrenhausen geführt wird. Ihre Hofdame, die Harling, ist bei ihr, zum Glück spricht sie so gut wie kein Französisch. Allerdings würde sie den meisten Themen, die Leibniz interessieren, auch auf Deutsch kaum folgen können, außer dem Hoftratsch natürlich, da muss man sehr vorsichtig sein, da scheint die Harding sogar Französisch zu verstehen. Die beiden Damen sind mit Stickarbeiten befasst, als er eintritt, und natürlich bleibt Sophie sitzen, während er sich verbeugt. „Vostre altesse…“ Er möge sich setzen, sagt sie, als sei er nicht zweieinhalb Jahre lang fort gewesen. Als habe sie sich nie um ihn gesorgt.
Die Mode hat sich etwas gewandelt. Zuletzt sah man mehr von ihren schönen Schultern, die nun ein blauweiß gestreifter Brokatstoff bis knapp über die Gelenke erklommen hat. Aber die Herzogin, diese Mutter von sieben Kindern, ist offenbar nicht älter geworden. Mit ihren nun 60 Jahren scheint sie der Natur weniger ausgeliefert als andere, sie kann es sich sogar leisten, offen zu lächeln. Nie in ihrem Leben hat sie einen jener Zahnmediziner aufsuchen müssen, die diesen Namen noch lange nicht verdienen und denen der Sonnenkönig den Verlust sämtlicher Zähne und ein Loch im Gaumen verdankt.
Und wen sieht sie vor sich, die Tochter der Elizabeth Stuart? Sein bräunliches Haupthaar sieht sie nicht. Auch im Sommer trägt er die bis zur Brust in schwarzen Locken herabwallende Perücke um sein blasses Gesicht. Sie sieht einen 46jährigen von mittlerer Statur, hohe Stirn, kräftige Augenbrauen, ein Anflug von Lächeln, etwas festgefroren. Es taut auf, als sie ihre Hofdame entlässt, um mit ihrem gelehrten Freund in den Großen Garten zu gehen, zur neuesten Baustelle.
Ja, noch ein Theater, ein kleines. Der Kies knirscht unter den Schritten der beiden, zwischen Blumen. Herrenhausen ist ihr Werk, ihr Reich, nicht das des Herzogs. Ernst August, sagt sie, habe kürzlich in Augsburg sogar seine Konversion anbieten lassen, um den Kurhut zu erlangen, die Kurwürde, deretwegen er auch den Hofrat auf die Reise schickte. „Es hieße eine Krone hergeben für einen Hut“, sagt Sophie. Er muss lachen. Das geschieht selten, dass Gottfried Wilhelm Leibniz von Herzen lacht, aber dieser Witz trifft den Kern einer komplexen Sache wie eine elegante Gleichung.
Die protestantische Krone Englands schwebt auf längere Sicht über eben der Dame, die hier über Hüte scherzt. Man weiß ja nie, wer wann stirbt, vielleicht kommt auch ihr Ältester auf Englands Thron. Sophies Gesicht verschattet sich, als sie ihn erwähnt. Georg Ludwig, jetzt 30, kommt nach seinem Vater, er hält sich Mätressen neben seiner Frau, er ist etwas brutal und mäßig intelligent. Das sagt sie nicht, das weiß Leibniz so gut wie jeder andere hier am Hof. Er, der neben Mathematik, Philosophie, Technik die europäische Diplomatie überblickt wie andere einen Stadtplan von Hannover.
„Ist es nicht wunderschön?“, sagt die Herzogin. Sie haben das Gartentheater erreicht. Er hat schon viel gesehen auf seinen Reisen, aber so etwas noch nie. Die Bühnengassen sind vollständig aus Hecken gebildet, tausende von jungen Hainbuchen aus dem Umland . Für Theater interessiert sich Leibniz in Maßen, doch er weiß die Tricks zu schätzen, die er hier sieht: Die Spielfläche steigt nach hinten an, ebenso wie die Heckenwände dorthin zusammenrücken. Eine Verengung des Raums, die die Perspektive verlängert. Er ist des Lobes voll.
Was er denn davon hielte, fragt Sophie ihren Hofrat, wenn zu den Hecken noch vergoldete Figuren kämen. Das sei vielleicht auch eine Frage des Geldes, wagt er einzuwenden. „Gesetzt, wir halten etwas für gut“, sagt sie beiläufig, „so ist es unmöglich, dass wir es nicht auch wollen.“ „Mais vostre altesse…das ist… “ „Ja, das ist von Ihnen, vor siebzehn Jahren! Ihre confessio. Und Sie fuhren fort: ,Gesetzt, wir wollen es und kennen zugleich die uns zu Gebote stehenden äußeren Hilfsmittel, so ist es unmöglich, dass wir es nicht ausführen.‘“
Er neigt den Kopf. Sie lächelt. Ein sehr feines Lächeln, ein Hauch Spott darin. Schon möglich, dass er es hier doch noch etwas länger aushält.
Hannover 1690: Der Hofmusiker
In der größten Stadt der Welt sitzt ein Achtjähriger am Cembalo der jungen Königin Charlotte und spielt vom Blatt, was sie und George III. ihm geben – Stücke von Händel und von beiden Musiklehrern der Königin, Johann Christian Bach und Carl Friedrich Abel, miteinander befreundet und bald auch mit dem Jungen, dessen Vater Leopold Mozart aus London nach Salzburg schreibt: „Alles hat er prima vista weggespielt“. Carl Friedrich Abel ist ein berühmter Gambist und Komponist. Eine Sinfonie von ihm schreibt sich der Junge ab.
Das war 1764 im Mai. Auch von da aus kann man auf den Juli 1690 in Hannover blicken, da kommt nämlich neben Herrn Weyhe gerade Herr Abel aus dem Opernhaus, ein Gambist, der von vielem etwas weiß, aber ganz sicher nichts von einem Enkel namens Carl Friedrich oder von irgendwelchen Mozarts. Es ist heiß. Die beiden Musiker in der Leinstraße lockern in der Mittagssonne ihre Hofkleidung, so weit es schicklich ist, den Oberrock trägt man ohnehin geöffnet. Wie der sich wieder aufgespielt hat, schimpft Ludolf Weyhe, etwas alterskrumm neben seinem stattlichen Kollegen Clamor Heinrich Abel.
Der will gerade antworten, als ein Vierspänner vorbeirasselt, am Wagenschlag zwei Löwen gelb auf rot, ein Löwe blau auf gelb. Ihre hochfürstliche Durchlaucht, die Herzogin. Sie wird wohl ihre neue Lieblingsbaustelle inspizieren, das Gartentheater. Noch ein Theater für diese Residenz. Vor einem Jahr erst ist das Opernhaus eröffnet worden, vor dem sie stehen.
Ja, Farinelli hat sich wieder aufgespielt, Franzose, eigentlich heißt er Jean Baptiste Farinel, Geiger, Konzertmeister hier seit zehn Jahren, scheint genauestens zu wissen, wie man in Versailles den Bogen führt, wo er doch nie war. Aber jetzt ist Versailles überall, wo man auf sich hält. Französische Flöten, französische Oboen, französische Verzierungen, Vorhaltstriller auf allen großen Terzen, man gewöhnt sich dran. Schlecht sei die neue Kantate ja nicht, die sie gerade probten, meint Abel, aber sein Kollege ist immer noch in Rage. Weyhe, der dienstälteste Musiker, seit 26 Jahren hier, wendig auf allen Tasten.
Beim vorigen Herzog hat man auch deine Musik noch gespielt, sagt Weyhe. Lange her, sagt Abel gleichmütig. Er kam vor 23 Jahren hierher. Als einzige haben die beiden alle Wechsel in der Hofkapelle überstanden. Als Abel seine Stelle antrat, waren sie acht deutsche Musiker neben 21 italienischen, hauptsächlich Sänger. Dazu noch zwei Franzosen, die waren damals noch nicht so in Mode. Dafür wurden hier am Hof sogar seine, Abels „Musikalische Blumen“ gespielt, für vier Instrumente. Im selben Jahr 1674 hat er sich stolz in Kupfer stechen lassen. Markantes Kinn, scharf geschwungene Augenbrauen, Perücke, Halsbinde, dazu eine Inschrift auf Latein.
Inzwischen ist er 56 Jahre alt. Eigentlich kann er nicht klagen. 220 Taler Gehalt im Jahr, das ist das Dreifache dessen, was ein Kapellmeister an einem kleinen Fürstenhof bekommt. Zuerst diente er dem konvertierten Herzog Johann Friedrich, der den ganzen Norden zum römischen Glauben bekehren wollte. Der sich, das muss man sagen, auf die Musik verstand. Er nahm seine Musiker auch mit nach Venedig. Abel, der Gambist, war ein paar Mal dabei, unvergesslich. Monatelang Karneval. Die Welfen hatten Logen in sechs Opernhäusern, ein Gefolge von 200 Leuten, Empfänge, Affären.
Darin hat es Ernst August erstmal nicht anders gehalten, nur von Musik versteht er nicht so viel. Er rückte in die hannoversche Residenz nach, als sein Bruder gestorben war. Man wechselte am Hof wieder zum Protestantismus, der Etat für Musik wurde um um drei Viertel reduziert, nur für Getöse ließ er etwas springen: Pauker und Trompeter bekamen fast doppelt soviel wie vorher. Aber am liebsten gab er sein Geld – SEIN Geld? – in Venedig aus, wo er auch eine uneheliche Tochter hat.
Zuviel Geld, zu viele Affären. Deswegen haben sie nun das Opernhaus hier, damit Ernst August nicht immer an die Lagune reist, aber dafür im Norden Aufsehen erregen kann. Fünf Ränge, 1300 Plätze. In einer Stadt von 10.000 Einwohnern! Logen mit Skulpturen, Wandbekleidung aus Goldstoff, den feuerroter Sammet durchwirkt. Was allein die weißen Kerzen kosten! Für eine große Wachskerze müsste ein Handwerker zwei Wochen lang arbeiten.
Diese Stadt und der Hof, das sind zwei Welten. Wie ein riesiges fremdes Herz sitzt das Schloss zwischen der Altstadt und der Neustadt am Fluss, mit all seinen Geheimen Räten und Kammerherrn und Hofgerichtsassesoren und Hofdamen und hunderten von Dienstleuten und, ja, seinen Hofmusikern aus ganz Europa. Mit einem Hofkapellmeister, der so viele Sprachen spricht wie der berühmte Herr Leibniz und eine Oper nach der anderen schreibt. Nicht für die Städter, sondern für die Welfen und ihre vornehmen angereisten Gäste und ihr Gefolge. Die Bürger kommen selten über die Wassergräben hinaus, außer auf dem Weg zu den umliegenden Dörfern. Das ihre wird es nie, das fremde Herz.
Wer sich nur ein paar Schritte vom Schloss wegbegibt, steht schon im Dreck. Es gibt nicht viele Straßen hier, auf denen es sich so rasseln lässt wie vorhin die Kutsche der Herzogin. Wer in Hofkleidung unterwegs ist, braucht schon wegen des Drecks eine Sänfte. Und nur um das Schloss herum ist es nachts beleuchtet.
Abel verabschiedet sich von Weyhe und stapft die paar Schritte durch den in der Sonne trocknenden Straßenschlamm zum Haus in der Kramerstraße, in dem er mit seiner Familie wohnt. Er nickt dem Bettler zu, der da immer am Torstein sitzt, dem hat er heute früh schon seinen Heller hingeworfen. Drinnen hängt ein Topf über der Herdstelle, seine Frau Magdalene stellt Teller hin. Wo denn die Katharina sei, fragt er. Die Dienstmagd werde nachmittags wieder da sein, sie habe ihr einen Kirchgang erlaubt. Eine Leichenbestattung.
Abel freut sich, als sein Sohn hereinkommt, sein jüngster, Christian Ferdinand, und mit ihm ein Freitischler aus seiner Schulklasse, den sie hier durchfüttern. Christian macht sich nicht schlecht mit seinen acht Jahren, auf Geige wie Gambe. Das liegt in der Familie, schon Abels Großvater war Musiker. Abel speist schweigend. Vielleicht überlegt er, ob dieses Leben, das er so lange schon kennt, etwas für seinen Sohn sein könnte. Der goldene Käfig des Hofs, die dreckigen Gassen der Stadt. Was er denn grübele, fragt ihn seine Frau. „Ach Herzenkind“, sagt er, „ich hab so lang schon keine Musik mehr geschrieben.“
Man wünschte, er wüsste, dass sein Sohn sich später in der Hofkapelle in Köthen mit dem neuen Kapellmeister dort befreunden wird, einem Herrn Bach, der dem exzellenten Gambisten drei Sonaten schreibt. Dass auch Christians Sohn ein Gambist wird und Komponist dazu, der es bis nach London bringt. All das hätte ja auch anders kommen können. Aber hier fängt es an.
Hannover 1690: Die beiden Mägde
Die beiden treffen sich auf der kurzen Brücke, wie immer. Zehn Meter, die von der dicht bebauten Leineinsel zur Neustadt führen. Katharina ist aus der Altstadt gekommen. Alke holt sie hier ab. Zwei Frauen Anfang 20 in Holzpantinen und weiten Röcken, weiße Tücher ums Haar gebunden, Dienstmädchen, Verdienst eineinhalb Groschen am Tag, sechs Euro. Alke Wichmanns hat nicht gewusst, ob Katharina Müller würde kommen dürfen, sie wollte es versuchen, ihre Herrschaft lässt mit sich reden, ein Hofmusikus und seine viel jüngere zweite Frau, mit der sie sich gut versteht. Sie habe der Frau Abel gesagt, meint Katharina, dass der vornehme Herr ihrer Freundin den Kirchgang nach Limmer verstattet habe, und das einem Sonnabend. Das hat geholfen. Sie machen sich auf den Weg zu einer Beerdigung, die unterhaltsam zu werden verspricht…
So viel Glück wie Alke, die mit ihrer Mutter im Haus des Herrn Behrens in der Neustadt arbeitet, haben die allerwenigsten Dienstmädchen. Herr Behrens ist bekannt für sein gutes Wesen. „Durch diese Tür trete kein Ungemach“, steht an seinem prächtigen Fachwerkhaus in der Langen Straße, und „Viel Gutes“, und zwar in hebräischer Schrift, die Alke sowenig lesen kann wie irgendeine andere Schrift, man hat es ihr gesagt. Elieser Leffmann Behrens ist furchtbar reich, das weiß sie, er liefert Kutschen an den Herzog, und wohl noch vieles mehr, aber in der Altstadt dürfte er nicht wohnen mit Frau und Kindern und Dienern, kein Jude darf dort wohnen. Das war schon immer so, hat ihre Mutter gesagt. Was beinah stimmt, es ist jetzt schon seit über hundert Jahren so. Aber wer will denn überhaupt in der dreckigen Altstadt wohnen?
Das sagt sie der Katharina nicht, die schon genug klagt über die Marktleute auf dem Marktkirchenhof, die da ihre Notdurft verrichten, nah dem Rathausbalkon, auf dem die Todesurteile verkündet werden. Lange bleiben die beiden nicht auf der Brücke stehen, bei diesem warmen Wetter stinkt der schmale Fluss vom Unrat. In der Neustadt ist es sauberer. Mitten hindurch führt breit die gepflasterte Calenberger Straße vorbei an stattlichen neuen Häusern – breite Steinfassaden, hohe Geschosse, Verzierungen. Viele vom Hof wohnen hier. Aber es gibt auch fein gekleidete Leute, die Katharina beim Schloss noch nie gesehen hat. Alke zeigt verstohlen auf zwei Herren in knielangen reichverzierten Justaucorps: „Dat sünt Hu-ge-notten!“
Im vorigen Jahr kamen die ersten sieben Familien, auf der Flucht vor dem Franzosenkönig, der in seinem Reich keine Protestanten mehr duldet. Dazu weitere neun jüdische Familien. Alke erzählt, dass es jetzt sogar eine kleine Synagoge und einen Rabbiner gibt. Katharina überlegt, was sie ihrer Freundin Interessantes aus der Altstadt erzählen könnte, aber ihr fällt nur wieder etwas vom Hof ein: der Elefant, der neulich über die Treppen des Schlosses hinaufgeführt wurde, damit die Herzogin sich an dem Rüsseltier erfreuen konnte.
Die beiden Frauen haben nun den Wall erreicht und das Tor zwischen den Bastionen, die in den fünfzig Meter breiten Graben ragen. Das Wasser umfasst die ganze Neustadt und die ganze ummauerte Altstadt. Hannover gilt als uneinnehmbar, aber an einer Eroberung dieser Stadt ist wohl niemand interessiert, nicht mal der Sonnenkönig. Über zwei Brücken müssen Alke und Katharina noch gehen, bis sie den Weg zum Ihmefluß erreicht haben. Über den führt ein hölzerner Behelf neben der Baustelle für die Steinbrücke.
Wie merkwürdig, von hier aus zurückzuschauen auf den gedrängten Haufen Häuser mit den vier Kirchtürmen unter der Julisonne! Es duftet nach Gärten und Feldern. Nun seien sie bald „to hus“, sagt Alke fröhlich, wobei sie noch durch das große Dorf Linden wandern müssen, um ins kleine Limmer zu kommen, wo gerade mal 180 Menschen leben. Hier leben auch Alkes Brüder, Katharinas Mutter und vor allem der berühmte Herr Sackmann. Den wollen sie heute hören, den Prediger, den sie seit Kindertagen kennen. Denn Jobst Sackmann predigt in ihrer Sprache, auf Plattdeutsch. Seine Kirche ist immer voll und die Leute sind mucksmäuschenstill, sofern er sie nicht zum Lachen bringt. Und nun ist im Dorf der Schulmeister gestorben. Alkes Brüder hat er unterrichtet, aber nicht Alke und nicht Katharina. Die beiden Frauen würden es nicht glauben, dass es im fernen Erfurt schon lange eine Schulpflicht für beide Geschlechter gibt.
Inzwischen sind sie bei so vielen Gemeinsamkeiten angekommen, dass Alke ihre Freundin zu fragen wagt, was denn aus dem wohlgestalten Bauernsohn aus dem Dorf im Norden geworden sei, von dem ihr Katharina im vorigen Sommer erzählt hatte. Der von der Kirmes, dem habe sie doch in aller Vorsicht das eine oder andere Stelldichein gewährt? Zum letzten, sagt Katharina nach einigem Schweigen, am Lister Turm nahe bei seinem Dorf, kam er nicht. Der Johann habe eine reiche Witwe geheiratet, eine… sie bricht ab, als sie sich anschicken, einen langsam dahinrollenden Heuwagen zu überholen. Hinter so einem Wagen, hinter seinem Wagen ist sie einmal mit Johann gegangen. Aber das sagt sie Alke nicht. Sie ist froh, dass sie nun hier mit ihr am andern Ende der Welt entlangwandert, auf das Dorf Limmer zu, wie gar nicht wenige.
Als sie die kleine Kirche erreicht haben, ist unten das Weibergestühl schon voll, die beiden müssen sich an den Rand stellen, und auf der Empore drängen sich die Männer. Katharina erkennt eine Hofdame. Es hat sich in der Stadt herumgesprochen, dass man hier draußen Interessantes zu hören bekommt. Sofern man es denn versteht. „De Dod let seck de Hand nich smären“, erklärt Jobst Sackmann schon bald nach Beginn seiner Leichenrede, neben des Schulmeisters Sarg, „saune ole Hore is he nich!“ So´ne alte Hure sei der Tod nicht, den könne man nicht kaufen, der komme, wie es ihm passe, den könne nicht mal die Schlosswache in Hannover aufhalten, und so hole er nicht nur einen Schulmeister, sondern auch Herzöge wie den Johann Friedrich, ein braver Mann, auch wenn er Katholik gewesen sei.
Was für eine schöne Musik man in dem seiner Schlosskirche habe hören können! Und nun schweift der Pastor ab und erzählt von den Blutschelmen, die da vormals sangen, die im Diskant so hoch quinkeliert hätten wie de besten Deeren, wie Mädchen, weil sie nämlich kapauniert waren, sagt Sackmann mit sattem Bariton und dann auf Hochdeutsch: „Dergleichen Leute sie in ihrer Sprache Kastraten heißen!“ Unversehens funkelt er von seiner Kanzel herüber zu Alke und Katharina und ruft: Was die beiden Mädchen da zu lachen hätten? Dabei haben sie gar nicht gelacht über die Kastraten, anders als die Männer auf der Empore. Sie würden sich lieber verkriechen, als der Prediger dröhnt, sie wüssten ja wohl, wo Barthel den Most holt. Und das in einer Leichenrede!
Über die Hofsprache zieht er nun her, da werde eine Kutsche jetzt Chaise genannt und eine Hure Mätresse, und jeder hier weiß, dass der Herzog Ernst August eine hat, dass sie zwei Kinder von ihm hat und eine Loge neben seiner in dem neuen Opernhaus, in dem noch keiner war von den Leuten hier und auch nie sein wird, außer natürlich die Hofdame hinten im Weibergestühl, die keine Miene verzieht und sicher Bericht erstatten wird, man weiß nicht wem.
Wir wissen nur, dass später, als Ernst August nicht mehr lebt, seine Witwe Sophie sich Abschriften von Sackmanns Predigten beschafft und sie mit Vergnügen weiterverschickt. Von Alke Wichmanns und Katharina Müller wissen wir nicht einmal die Namen. Wir wissen nur, dass es viele wie sie gab, des Hofes wegen, in diesem Jahr fast tausendvierhundert Mägde und Zofen in dem kleinen Hannover. Schreiben kann kaum eine, und über keine von ihnen wird jemals etwas geschrieben. Aber wenn wir die Kindeskinder von Alke und Katharina sehen wollen, brauchen wir uns nur HIER umzuschauen.
Diese Texte sind urheberrechtlich geschützt. Sie entstanden für das Programm “1690: Ein Festkonzert” im Rahmen von „Herrenhausen Barock“ am 19. Februar 2023 in der Galerie Herrrenhausen. Mitwirkende: Dorothee Mields, Sopran, Volker Hagedorn, Rezitation, la festa musicale, Ltg. Anne Marie Harer.
Das Modell der Stadt Hannover im Jahr 1689 befindet sich im Neuen Rathaus der Stadt, es entstand auf Basis zeitgenössischer Karten und einer für dieses Jahr vorliegenden sehr differenzierten Steuererhebung. Von den Publikationen, die mir als Quellen dienten, sei hier nur eine genannt, aber hervorhebend: Der berühmte Herr Leibniz – Eine Biographie (München 2000) von Eike Christian Hirsch. Diesem Buch verdankt sich vieles im Text über Leibniz und die Herzogin. Ich schrieb ihn auch in Gedanken an den wunderbaren Schriftsteller, Freund und Ermunterer Eike Christian Hirsch, der am 6. August 2022 mit 85 Jahren in Hannover starb.