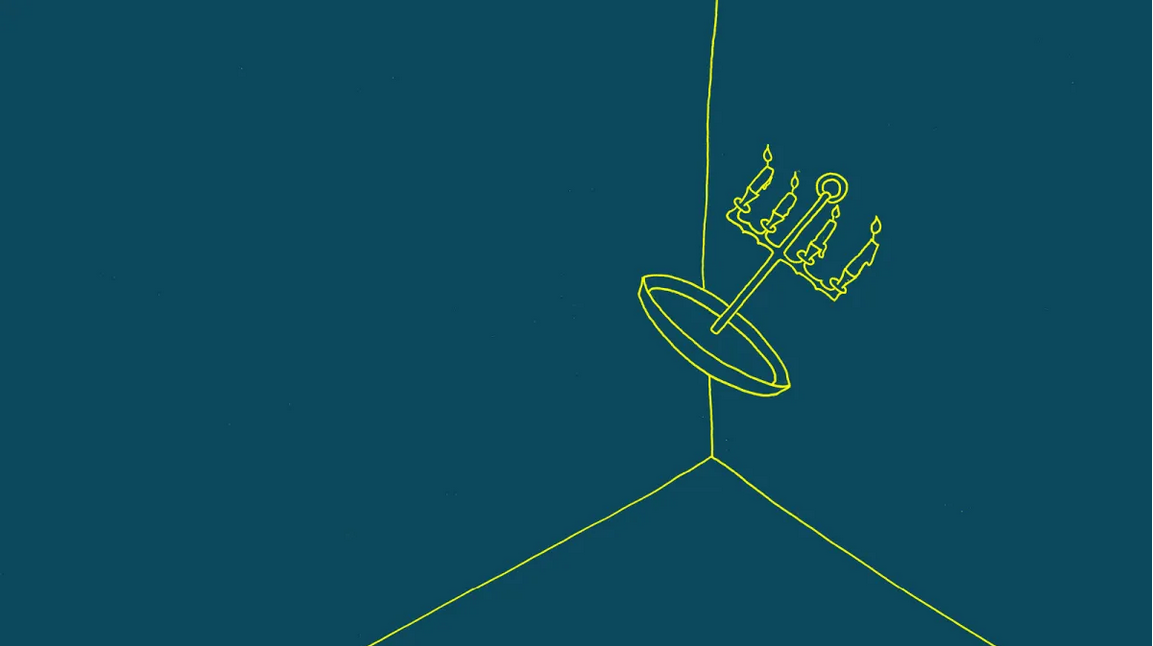Vor 50 Jahren kam Tarkowskis ›Solaris‹ in die Kinos, vor 61 Jahren Pasolinis ›Accattone‹ – beides Filme, an deren Magie und Intensität Werke von J.S. Bach großen Anteil haben und die uns gleichzeitig diese Musik besonders nahebringen.
Eigentlich kann es diese Frau gar nicht geben. Das hatte ich vergessen, als ich auf die Filmszene stieß, ein Ausschnitt. Sie sitzt, die braunen Haare zum Zopf gebunden, im Kleid auf einem Tisch in einem getäfelten Raum, einer Bibliothek, neben ihr steht ein Mann im Anzug, Mitte vierzig, die Haare etwas zerzaust, und spricht sie an: »Harey!« Sie lächelt. Sie hat ein Gesicht wie ein Engel, er blickt melancholisch, ratlos. Dann beginnen sie zu schweben, in die Luft gelehnt, und Orgelmusik setzt ein. Mit ihnen schwebt ein Kerzenhalter, ein Buch. Man könnte es unfassbar kitschig finden. Es ist aber wunderschön, weil die Musik die beiden umfasst: J.S. Bach, Choralpräludium f-Moll, BWV 639.
Vor 50 Jahren wurde Solaris erstmals in Cannes gezeigt, der dritte Film des russischen Regisseurs Andrei Tarkowski, der später ins französische Exil ging, und immer noch ist es ein Film von magischer Kraft, nicht zuletzt wegen Bach. An Bach allein liegt es aber nicht, denn dann würden alle bis jetzt 1066 Filme unsere Aufmerksamkeit verdienen, in deren Soundtracks Musik des Thüringers (der eben nicht nur »Thomaskantor« war) eingesetzt wird. Und da sind die seit 1941 produzierten rund 30 kurzen und langen Filme über diesen Musiker noch gar nicht mit eingerechnet. Tarkowskys Werk indessen hat es sogar in die Gefilde der Musikwissenschaft geschafft, mit Musik und Imagination – J.S.Bach in Tarkowskijs Solaris.
1977 kam der Film in die bundesdeutschen Kinos; wann ich ihn erstmals sah, weiß ich nicht mehr. Ich hatte jetzt nur noch im Kopf, dass zentraler Schauplatz eine Raumstation im Orbit des Planeten Solaris ist, von Stanisław Lem im gleichnamigen Roman erdacht, aber nicht mehr, dass dort immer wieder Harey in Fleisch und Blut erscheint, die junge Frau des Wissenschaftlers Kris Kelvin, die sich vor seinem Weltraumeinsatz das Leben genommen hat. Man muss das auch gar nicht wissen, um schon von der levitation scene fasziniert zu sein. Auch Pieter Bruegels Jäger im Schnee von 1565 spielen hier eine Rolle. Die Epochen durchdringen einander, die Bedeutungen, und der Einsatz des Bach’schen Präludiums ist ähnlich genial wie die Komposition selbst.
Wenn mit C-Dur die Dominante von f-Moll erreicht ist, geht es über ein Des in der Oberstimme zu einem Takt, der durch die fließende Bewegung der Mittelstimme zwischen As-Dur und c-Moll schwebt, weiter zu einem Des-Dur über einem C im Bass…man könnte auch sagen, auf Szene und Bilder bezogen, es ist, als breite die Musik ihre Arme weiter aus, um alles zu verbinden. Darum denkt man gar nicht so sehr an SciFi, Gravitation, Plots und Kinotricks, sondern viel weiter. Das Schweben ist auch eine Metapher für die Liebe und das Lieben, zugleich für den Verlust des Bodens unter den Füßen in einer instabilen Welt.
Und die Ratlosigkeit, die Melancholie, die Trostbedürftigkeit des Mannes muss nicht daher rühren, dass die Frau nur eine Erinnerung sein kann. Es ist darin auch ein Wissen um das Zeitvergehen, durch das Liebe und Schönheit nicht relativiert, sondern vertieft werden, so wie bei Bach der Glaube. Sein Präludium, vor 1720 entstanden, gilt dem Choral Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (es hat schon Ferruccio Busoni zu einer Bearbeitung für Klavier gereizt).
Die Bilder von Solaris zeigen uns das Potential dieser Musik, das über Religion hinausgeht und sich zugleich mit ihren Quellen berührt. Die großen Regisseure bedienen sich nicht bei Bach, sie arbeiten mit ihm zusammen. Im Kino ist seine Musik vielleicht nie so herausgefordert worden wie 1961 in Pier Paolo Pasolinis Accattone, einem Schwarz-Weiß-Film über das Leben im römischen Subproletariat.
Mit fast unerträglicher Nähe und Dichte zeigt Pasolini das Leben am Rand der Gesellschaft, am Rand eines weniger ewigen als dreckigen und brutalen Rom. Die Darsteller sind Laien aus dem Milieu, manchen fehlen Zähne, alle sind von Armut gezeichnet. Pasolini verwendet den Schlusschor der Matthäuspassion, aber mich beeindruckt besonders das Adagio aus dem 1. Brandenburgischen Konzert.
Man hört es (hier bei 7’35), als der Zuhälter Accatone seine einzige Prostituierte aufsucht, die sich von einem Unfall erholt. Schäbiges Zimmer unterm Dach mit Herd und Bett, zwei Frauen, viele Kinder. Die Musik bildet keinen Gegensatz dazu, keine Gegenposition. Sie wird nicht eingesetzt, um Glanz in die Hütte zu bringen. Sie scheint dieses Leben zu kennen, zu sehen, auch die unfassbare Entfernung zu dem, was Glück sein könnte. In Bachs weiten Linien, hinter den Dialog geblendet, wird tiefes Verstehen spürbar. »Absolute Musik«? Losgelöst von allem? Wenn das so wäre, was könnte uns berühren?

Solaris und Accattone, kein bisschen patiniert, könnten auch Interpreten zum Nachdenken bringen. In der »Alten Musik« wird inzwischen so viel von so vielen »richtig« gemacht, dass sich eine gewisse Unverbindlichkeit eingestellt hat. Man kennt die historischen Bedingungen Bachs, die Affekte, die Klangfarben, die Stimmhöhen, die Chorgrößen, die Anlässe, die Instrumente, die kirchlichen und weltlichen Bezüge. Und was ist mit dem Leben, mit Angst und Sehnsucht und Glück? Dürfen sich damit nur die Zuhörer befassen?
PS: Falls jemand im Ernst mal das ganze Kino auf Bach durchchecken will – ich wüsste ja gern, wie er in Roswell – Ufo-Absturz über New Mexico von 1994 eingesetzt wird.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand als Nr. 38 der Kolumnenreihe “Rausch & Räson” für das Magazin VAN und ist dort seit 15. Juni 2022 online. Die Illustration ist von Merle Krafeld. Im Filmstill aus “Solaris” zu sehen: Hari (Natalja Bondartschuk), Cervantes´ “Don Quixote” (1605/1615) in der 1863 von Gustave Doré illustrierten Ausgabe, ganz rechts “Die Jäger im Schnee” von Pieter Breughel dem Älteren, 1565. Das Filmstill aus “Accatone” zeigt Franco Citti in der Titelrolle, mit namentlich nicht genannten Laiendarstellern.