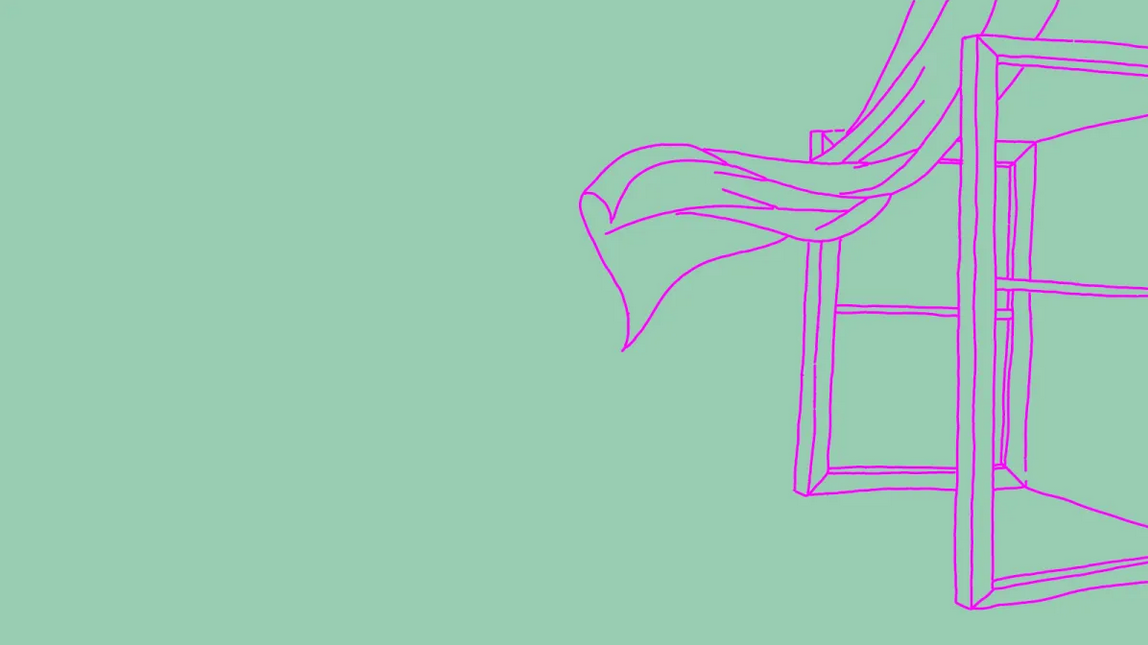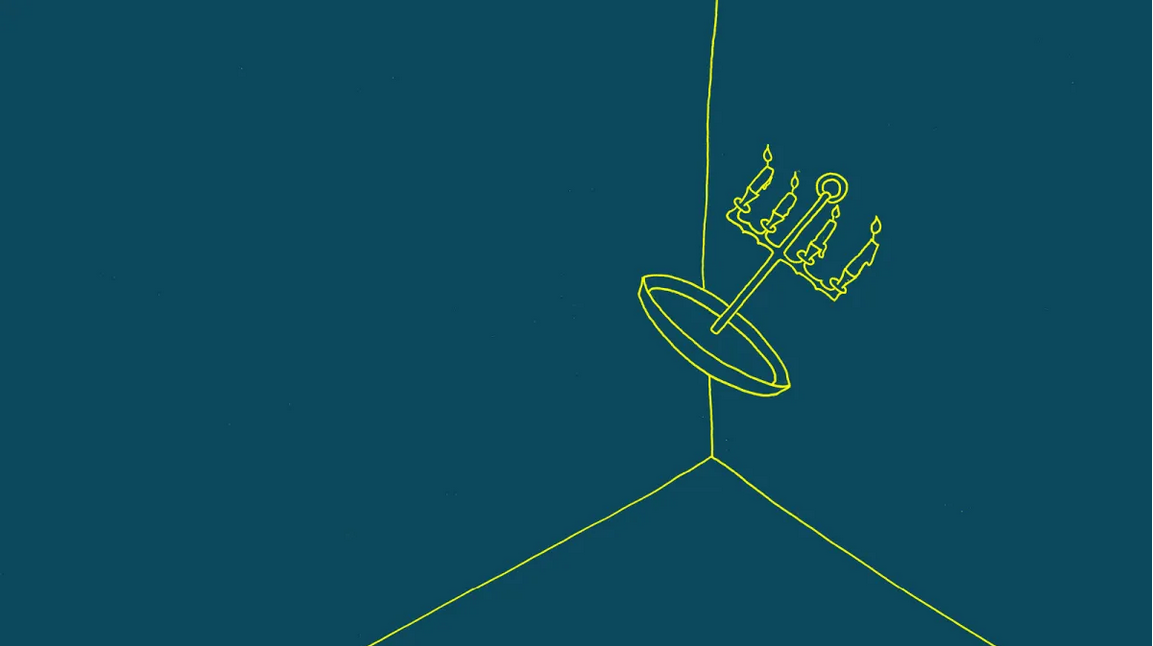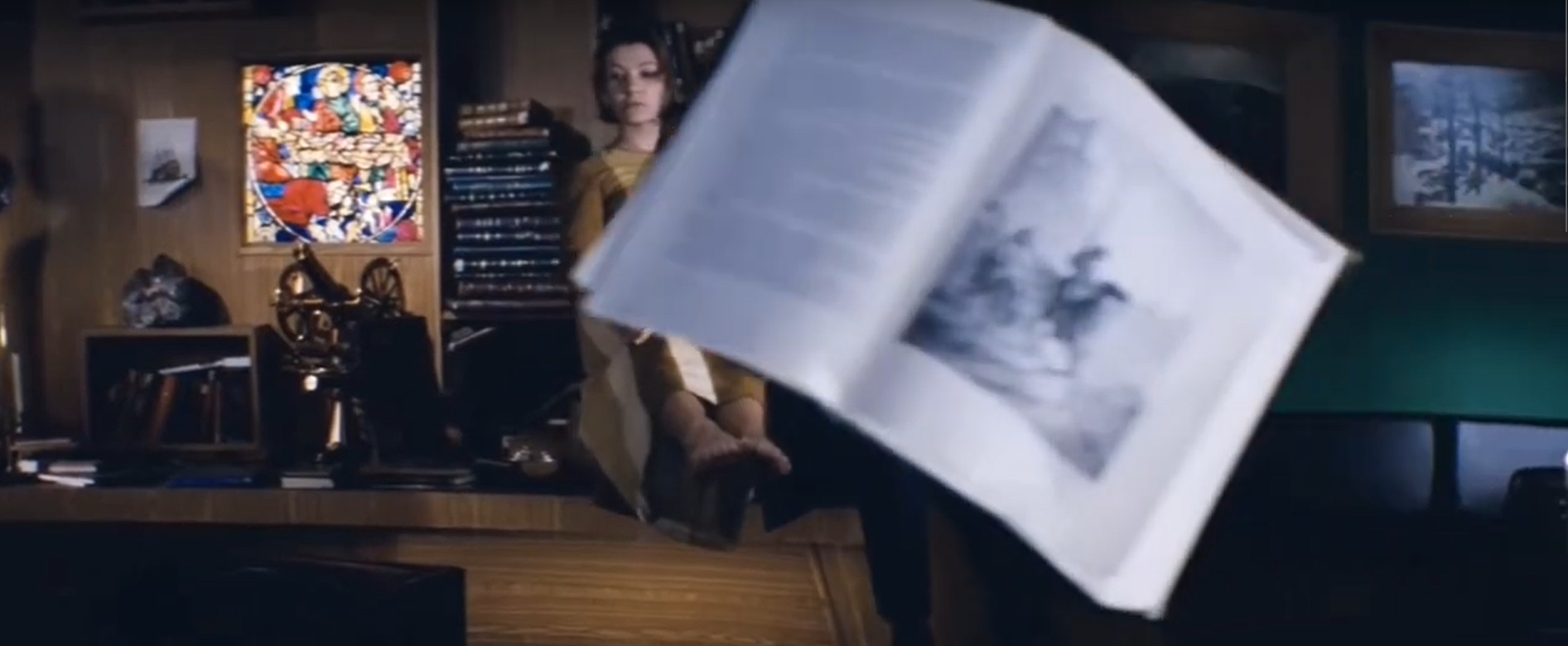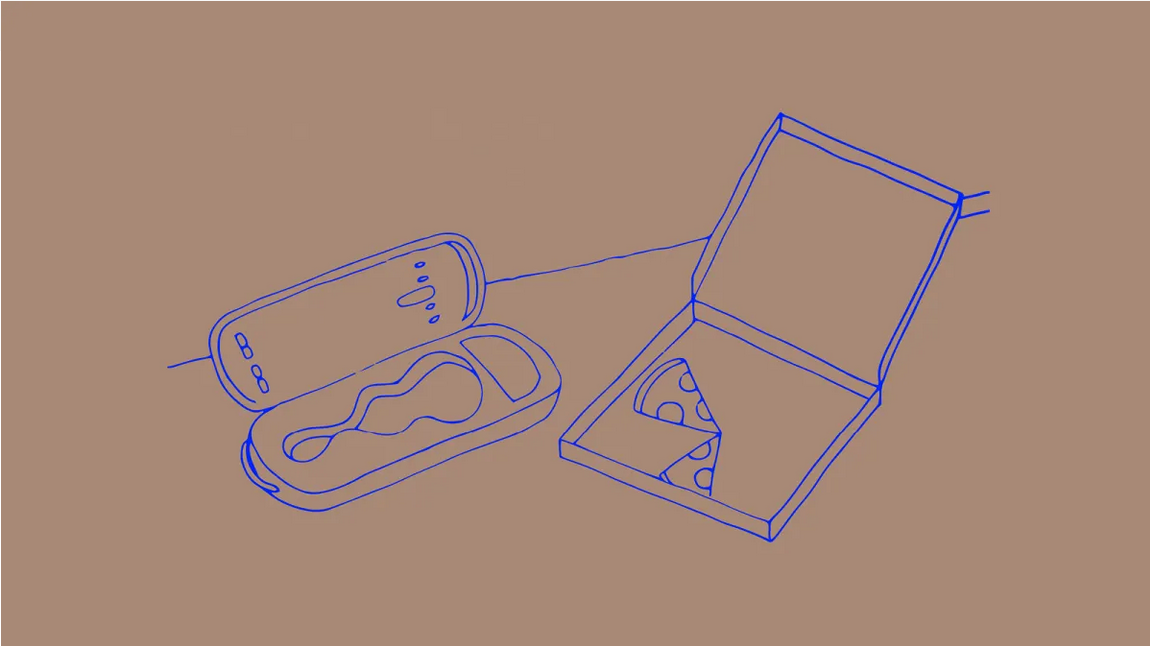Mit knapp dreißig Jahren Verspätung kommt Keith Jarretts Aufnahme von Sonaten Carl Philipp Emanuel Bachs heraus. Ein guter Zeitpunkt. Inzwischen braucht der Komponist keine historischen Koordinaten mehr, um verstanden zu werden.
Wie gelassen das beginnt. Und gelassen bleibt, im besten Sinn. Also nicht gleichgültig, nicht stagnierend, alles lebt und leuchtet. Aber die Musik wird nicht ergriffen und präsentiert, nicht analysiert und interpretiert. Gegriffen wird sie schon, es sitzt ja ein Pianist am Flügel, nur scheinen seine Hände, die wir nicht sehen können, sich sehr entspannt zu bewegen. »Er probierte ein neues Pianoforte aus, und auf eine freie, sorglose Weise warf er Gedanken und Ausführungen hin, die jeden anderen in Aufregung versetzt hätten.« Ein bisschen so, wie Carl Philipp Emanuel Bach improvisierte, als ihn im Herbst 1772 der Musikreisende Charles Burney in Hamburg besuchte, so spielt Keith Jarrett seine Musik, Sonaten, die knapp dreißig Jahre vor Burneys Besuch entstanden.
Sie heißen Württembergische Sonaten nach ihrem Widmungsträger, einem jungen Herzog und Schüler von CPE am Potsdamer Hof Friedrichs II., aber an historische Begleitumstände habe ich beim Hören selten so wenig gedacht wie bei den Aufnahmen, die Jarrett, der Jazzpianist mit klassischer Ausbildung, vor auch schon wieder knapp dreißig Jahren machte, in New Jersey mit Tonmeister Peter Laenger, für ECM. Erst jetzt hat das Label sie herausgebracht, und irgendwie ist das ein guter Zeitpunkt. CPE hat inzwischen zwei Phasen seiner Neuentdeckung hinter sich – die, in der ihn die Pioniere überhaupt erst wieder spielen mussten, und die, in der er schon ein Begriff war, aber man immer noch staunte, dass er zu Mozarts Zeit berühmter war als sein Vater.
»Die Carl Philipp Emanuel Bachsachen könnten sie mir wohl einmal schenken, sie vermodern ihnen doch.« Das schrieb 1812 Beethoven seinem Verleger. Da war CPE für den Musikbetrieb bereits Schnee von gestern, auf den bald auch noch der Schatten seines neu entdeckten Vaters fiel. In dem hat der zweitälteste Sohn sich selbst nach seiner Renaissance im späten 20. Jahrhundert noch bewegt – und im Hoheitsgebiet der historisch informierten Musiker, denen diese Renaissance zu verdanken war. JSB auf modernem Flügel, das war trotz kleiner Zänkereien nie ein Problem, aber seine Söhne sollten in der betreuten Werkstatt bleiben. Nur Experten würden ihre Musik zum Sprechen bringen können. Dass den Koryphäen der Alten Musik das gelang, ist übrigens auch eine Voraussetzung für Phase drei.
Jetzt können wir die Fenster öffnen. Aber hat nicht schon lange zuvor Glenn Gould die a-Moll-Sonate am modernen Flügel gespielt statt am Cembalo, 1968? Eine feine Sache für alle, die Laborversuche und Skalpelle mögen, mit Musik hat das sterile Gehacke für mich wenig zu tun. Um so lebendiger ist Daniil Trifonov 2021 mit Bach: The Art of Life, mit Musik von JSB und seinen vier Komponistensöhnen.
Dass Keith Jarrett schon vor drei Jahrzehnten mit den Württembergischen souverän am Cembalo vorbeizog, liegt sicher auch an seiner Jazzkarriere. Ein Jazzer hat keinen Ruf als Klassikinterpret zu verlieren, und er blickt anders auf die Schrift. Nein, Jarrett macht keinen Jazz aus Bach, falls darunter spontanistische Willkür verstanden werden sollte. Er spielt jedes Forte, jedes Piano, jede Verzierung, die der 30-jährige Bach drucken ließ, jede Tempoänderung – aber nie extrem. Er hat keine Kurse bei Bob van Asperen besucht. Das »Sprechende«, die Affekte sind nicht das Bestimmende. Er arbeitet Details nicht extra heraus. Krasse Akzente sind selten. Natürlich unterscheidet man legato und staccato, aber eher so nebenher. Jarrett kann allerdings sehr trennscharf spielen, wenn er will, technisch ist alles da.
Er formt Linien und Klänge weniger, als dass er ihnen nachsinnt, während seine Hände sie freiwerden lassen, er scheint hinter ihnen etwas zu sehen, weniger eine Person als eine Gegend. Es ist eine rare Mischung aus Bewusstheit und Absichtslosigkeit, die man da hört. Um so realer und lebendiger wird alles, um so mehr ist man verblüfft oder sogar entzückt von jähen Verzögerungen, harmonischen Gewagtheiten. Der Fis-Dur-Septnonenakkord ohne Fis, mit einem d als Vorhalt vorm cis am Ende des Moderato der h-Moll-Sonate! So sensationell ist der aus analytischer Nähe besehen nun auch wieder nicht. Aber bei Jarrett steht er da wie eine schöne fremde Blüte.
Und Carl Philipp steht die ganze Zeit im Freien. Nicht als interessante Gestalt irgendwo zwischen Johann Sebastian und Wolfgang Amadeus, nicht an irgendeinem historischen Platz, sondern mit Blick auf eine eigene Welt, so weit, dass sie sich mit unserer berührt und das Licht verändert – zum Helleren, in diesem Fall. Befreiend, wenn man im Allegro der h-Moll-Sonate zwar die kontrapunktische Linienführung von JSB wiedererkennt, aber endlich nicht mehr reflexhaft denkt: Ach ja, der Vater, sondern, wie bei jedem anderen Großen, das Material und den Klang einer Zeit integriert sieht. Zu dem, wie in der e-Moll-Sonate zu hören, auch Domenico Scarlattis legendäre Essercizi beitrugen. Aber das ist jetzt schon wieder viel zu historisch.
Von solchen Koordinaten kann uns Keith Jarrett 86 zeitlose Minuten lang befreien, an einem wunderbar plastisch aufgenommenen Flügel. Es sind Sommertöne, in jeder Hinsicht, aufgenommen im Mai 1994, aber diese beiden CDs halten auch dem Dunkel und der Kälte stand.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand als Nr. 39 der Kolumnenreihe “Rausch & Räson” für das Magazin VAN und ist dort seit 21. Juni 2023 online. Die illustration ist von Merle Krafeld.