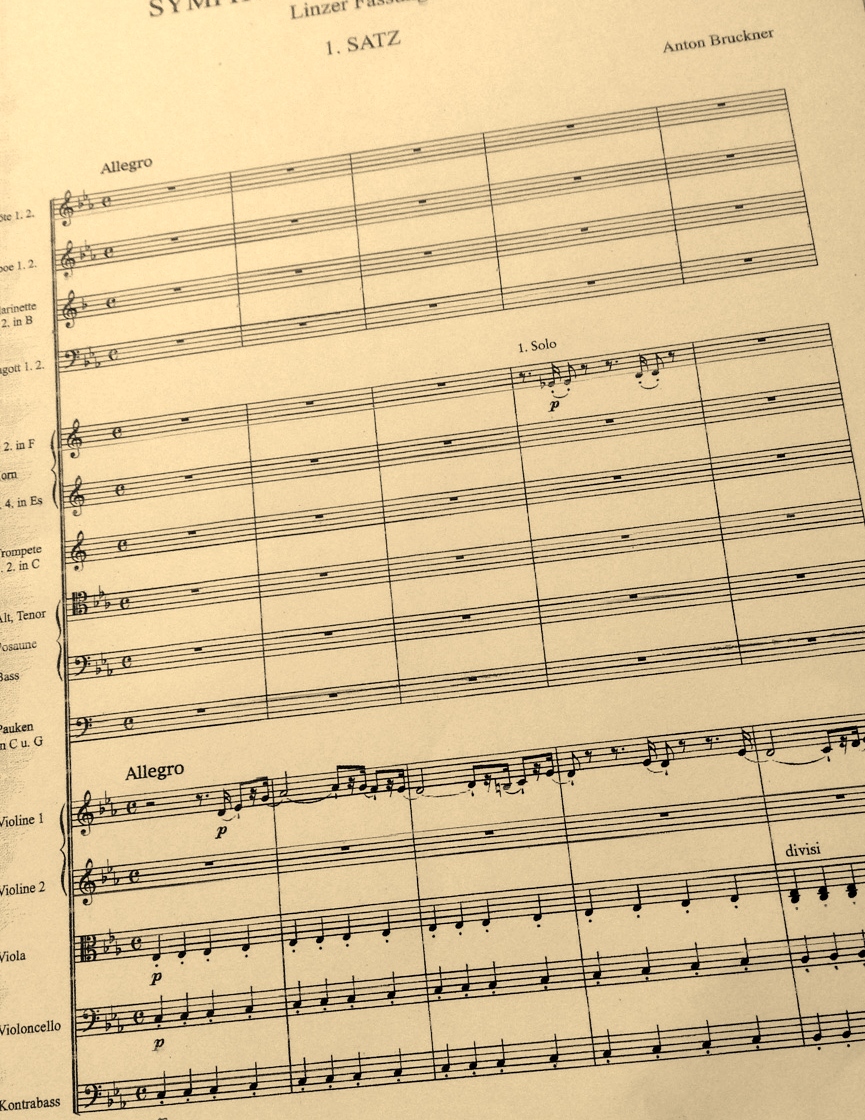In drei Werken von Strauss, Mozart und Hartmann spiegeln sich Lebenslagen und Weichenstellungen, die nicht unterschiedlicher sein könnten
So begeistert war Hans von Bülow nun auch wieder nicht, wie es sich Richard Strauss später einbilden durfte. Aus mehreren Gründen blickte er skeptisch auf die Partitur des Jünglings, die ihm ein Münchner Verleger nach Meiningen geschickt hatte, und schrieb am 27. November 1883: „Sie ist gut gemacht u. wohlklingend – freil. Phantasie u. Originalität – vacat.“ Das Urteil bezog sich auf die Serenade für dreizehn Blasinstrumente, die Strauss drei Jahre zuvor, mit siebzehn Jahren, geschrieben hatte. Bülow wusste, wovon er sprach, wenn es um Originalität von Zeitgenossen ging. Seine Meininger Hofkapelle spielte neben Brahms auch Berlioz; er hatte eng mit Liszt und Wagner zusammengearbeitet und in München die Uraufführung von Tristan und Isolde dirigiert.
Darum wusste Bülow auch gut, wer dieser Strauss war, nämlich der Sohn des Ersten Hornisten der Münchener Hofkapelle, Franz Strauss, der beim Tristan 1865 keinen Hehl daraus gemacht hatte, dass er Wagner verabscheute. Bülow hatte darüber hinweggesehen, weil der Hornist überragend gut war; Wagner selbst bestand auf dessen Mitwirkung beim ersten Parsifal 1882, von dem wiederum der 18jährige Richard Strauss überwältigt war. Doch seine Serenade hatte der junge „Pschorr-Genius“ – wie ihn Bülow in Anspielung auf seine Mutter aus der Bierdynastie Pschorr nannte – noch fern von Wagner komponiert, unterrichtet von Kollegen des Vaters. Die Serenade bot Entfaltung aller Bläserschönheit, Transparenz, fasslichen Aufbau, Geschmeidigkeit.
Strauss spielte Geige und Klavier, kein Blasinstrument – und auch für den Sohn eines Hornisten ist es nicht selbstverständlich, neben vier Hörnern auch mit Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten so souverän umzugehen, wie es hier geschieht, in chorischen Gegenüberstellungen von Holz- und Hörnerklang, in der Auflösung von Tuttiklang in Arpeggien. Nach einem Oboenrezitativ entwickelt sich ein Minidrama zwischen Fagotten und hohen Bläsern, verdichtet sich klanglich und ist dann doch kein Drama – so wie alle Expressivität, die hier und da schimmert, nur eher ein Mittel ist und auf kein Dahinter verweist. Eine Studie also – aber von einer Eleganz, die ihren eigenen Charakter hat.
 Die Meininger Hofkapelle 1882 mit ihrem Chefdirigenten Hans von Bülow
Die Meininger Hofkapelle 1882 mit ihrem Chefdirigenten Hans von Bülow
Das war mehr als nur gut genug, um gespielt zu werden, und erlebte als erstes Werk von Strauss eine Uraufführung außerhalb seiner Heimatstadt München. Franz Wüllner, ab 1884 dann Kapellmeister des Gürzenich-Orchesters, dirigierte die Serenade 1882 in Dresden. Aber die Weichenstellung für Strauss´ ganzes Leben führte das Stück erst herbei, als Hans von Bülow es nach erster Skepsis ins Meininger Programm nahm, im Dezember 1883. Die Serenade kam gut an, sie „zeigt unsere Bläser in ihrem virtuosen Glanz“, fand Bülow. Er applaudierte dem Komponisten vor versammeltem Orchester, gab nun selbst ein Bläserwerk in Auftrag, eine Suite, und ließ sie Richard Strauss, der nie öffentlich am Pult gestanden hatte, 1884 selbst in einer Münchener Matinée dirigieren. „Ein geborner Dirigent“, urteilte Bülow danach und machte ihn umgehend zum zweiten Hofkapellmeister auf dem Meiniger Musenhügel. Mit 21 Jahren trat Strauss eine Stelle an, um die Gustav Mahler zuvor Bülow geradezu angefleht hatte. Dessen Sinn für Humor kann übrigens die Pointe nicht entgangen sein, mit der Strauss´ Serenade endet. Als große Vorgängerin hat sie die Gran Partita von Mozart, eine Serenade für vierzehn Bläser – plus Kontrabass. Dieses Streichinstrument setzt auch Strauss ein, ganz am Schluss: Nach 174 Takten ein subtiler Gruß an den Meister aus Salzburg.
*
Als Meister wurde Mozart in Salzburg nicht behandelt, er wollte fort. „Trauerig genug“, schrieb er rückblickend, „wenn man seine junge jahre so in einen Bettel ort in Unthätigkeit verschlänzt“. Es waren nicht die Salzburger Umstände allein, die ihn frustrierten, seit er im Januar 1879 von einer sechzehnmonatigen Reise nach München, Mannheim, Paris zurückgekommen war. In Paris hatte er das Sterben seiner Mutter erlebt und als Musiker nicht reüssiert, in München hatte Aloisia Weber seinen Heiratsantrag abgelehnt, viel komponiert hatte er nicht, die Reise war ein finanzielles Desaster. Und in Salzburg erwartete ihn mit Fürstbischof von Colloredo ein zwar hochintelligenter, aber wenig duldsamer Dienstherr.
Mozart war Organist und Konzertmeister mit der Verpflichtung zum Komponieren. Er schrieb viel, seit er wieder die „sclaverey in salzbourg“ angetreten hatte, aber nicht das, wovon er träumte, eine Oper. Im Mai 1780 kam endlich die erlösende Nachricht: In München wünschte man eine Festoper zum nächsten Karneval. Der Stoff: Idomenée, eine französische Vorlage, Probenbeginn im November. Mozarts Hochstimmung spiegelt sich im Übermut der Einträge, die er im gemeinsam geführten Tagebuch seiner Schwester hinterließ. Während er am Idomeneo und der letzten Sinfonie für Salzburg arbeitete, Ende August, notierte er: „den 62:ten apud die conteßine de Lodron. alle dieci e demie war ich in templo. Posteà chés le signore von Mayern. Post prandium la sig:ra Catherine chés uns. wir habemus joués colle carte di Tarock. à sept heur siamo andati spatzieren in den horto aulico. faceva la plus pulchra tempestas von der welt.“
Er war also am 26. August bei den Komtessen Lodron gewesen,um 10.30 in der Kirche, dann bei Frau von Mayrn und ihren Töchtern, nach dem Essen war Katherl zu Mozarts gekommen, Katherina Gilowsky, Tochter des Hofbarbiers und langjährige Freundin, um Tarock zu spielen, um 19 Uhr ging man bei schönstem Wetter im Hofgarten spazieren. Irgendwann muss er auch noch komponiert haben, denn drei Tage später schrieb er aufs dicke Papier der neuen Partitur: „Sinfonia / di Wolfgango Amadeo / Mozart mpa / li 29 d´agosto / Salzbourg / 1780“. Vermutlich wurde das neue Werk dann in einem Hofkonzert gespielt.
Festlicher Beginn, C-Dur, Trompeten, marschartiger Rhythmus, aber nach vier Takten eine buffonesk wiederholte Floskel, fast schon ein wenig Osmin aus der Entführung darin. Festliche Fortsetzung in F-Dur, doch nach vier Takten ein Echo in Moll. Beiläufig stellt er das stattliche Portal in Frage, beiläufig lässt er später ein paar Takte zwischen G-Gur und g-Moll irisieren und feiert danach ausgiebig die Dominanttonart. Aber nur, um einen Schatten hereinbrechen zu lassen, keineswegs mehr beiläufig. Es ist weniger der Gang von G-Dur 7 nach As-Dur als die Ausdehnung dieser Entwicklung über dem drohend wiederholten Intervall As-G im Bass, das ein anhaltendes Gefühl von Instabilität vermitteln kann. Dem festlichen Glanz danach bleibt etwas Vorläufiges.
Es folgt ein langsamer Satz, der keiner ist, nur Streicher, zwei Bratschenstimmen. „Andante di molto“ bedeutet „sehr gehend“, im Stimmenmaterial hat Mozart die Anweisung „più tosto Allegretto“ ergänzt, „eher etwas fröhlich“. Gleichwohl hat das Stück eine schwebende Melancholie, der im Finalsatz (das Menuett davor hat Mozart herausgerissen) das absolute Gegenteil folgt. Ein schneller Sechsachteltakt, in dem der Elan des Wortspielers Mozart prickelt. Man sollte die Musik nicht auf seine Aufbruchslust herunterbrechen, aber etwas davon ist ihr, und in der zweiten Themenhälfte eine verblüffende Nähe zum Jahr 1968: „Ob-la-di, ob-la-da … La-la how the life goes on“.
*
Das war nun gerade nicht die Verfassung, in der Karl Amadeus Hartmann am 20. Juli 1939 aus München an den Dirigenten Hermann Scherchen schrieb: „Jetzt beginne ich eine Trauermusik in einem Satz für Streichorchester zu schreiben. Wenn ich im Herbst nach Winterthur komme, so hoffe ich Ihnen diese Arbeit zeigen zu können.“ Scherchen, vierzehn Jahre älter als der 1905 geborene Hartmann, hatte den jungen Münchener erst „darauf gebracht, wohin es mit mir und meinen Kompositionen eigentlich hinauswollte.“ Gleich nach der „Machtergreifung“ Hitlers war Scherchen, überzeugter Kommunist, emigriert; 1935 bescherte er Hartmann in Prag einen Erfolg mit der Tondichtung Miserae. Im „Dritten Reich“ wurde Hartmann dagegen weder gedruckt noch gespielt.
Um so mehr war er auf Interpreten im Ausland angewiesen, besonders auf Scherchen. Die „Trauermusik“, die Hartmann ihm 1939 ankündigte, verrät im später zu Concerto funebre geänderten Titel, welcher Zeitgenosse den Komponisten besonders beeindruckte: Paul Hindemith. Der hatte 1936 für die BBC nach dem Tod des englischen Königs George V. die Trauermusik für Viola und Streicher geschrieben. Hartmann übernahm die Besetzung (bis auf die Soloviola), die Viersätzigkeit und den Einsatz eines Chorals. Bei ihm wurden die vier kurzen Sätze verbunden und aus einem zwei Choräle. Hartmanns Trauer galt nicht dem Widmungsträger, „meinem lieben Sohn Richard“. Der war zur Zeit der Komposition vier Jahre alt. Doch im Sommer 1939 standen alle Zeichen auf Krieg.
Was die Solovioline in der „Introduktion“ spielt, ist das Hussitenlied Die ihr Gottes Streiter seid von 1430. Diese Melodie böhmischer Rebellen hatte schon Smetana verwendet, für Hartmann war sie eine Reverenz vor der zerschlagenen Tschechoslowakei. Mit einem anderen Zitat eröffnen die Streicher den Choral im vierten Satz: In Zeitlupe paraphrasieren sie einen Trauermarsch aus Hartmanns Geburtsjahr 1905, als die Melodie für die Toten der ersten, gescheiterten russischen Revolution entstand: Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. In der Sowjetunion wurde sie bei jeder Staatstrauer gespielt, uns ist sie sowenig geläufig wie der Hussitenchoral. Aber Hartmanns Partitur erschließt sich in ihrer Substanz auch ohne Kenntnis solcher „Fußnoten“, die - oft auch zu jüdischen Melodien führend – sein ganzes Œuvre wie ein zweiter Text durchziehen. Der bleibt in der Tiefe seiner Musik immer spürbar.
So wenig wie eine Botschaft wird auch die Virtuosität der Violine ausgestellt, obwohl sie weit über das hinausgeht, was Hindemith in seiner Trauermusik der Viola abverlangt. Die Solostimme hat im zweiten Satz etwas von einem singenden Erzähler, dem Orchester in rezitativartigen wie ariosen Partien verbunden. Im dritten Satz werden alle zu Akteuren, da ungeheurer Druck in ein komplexes Drama umschlägt, mit szenischen Kontrasten und einem aggressiven Motiv, das an Schostakowitsch erinnert. Nicht, weil Hartmann ihn zitiert, sondern weil sein Concerto funebre auch ein Konzentrat von dem ist, was in vielen Musiksprachen dieser Jahre mitschwingt, vom Signalhaften bis zu einer offenen Harmonik, in der Erinnerungen an die alte Diatonik durchschimmern.
Nicht Hermann Scherchen dirigierte dann die Uraufführung am 29. Februar 1940 in St. Gallen, sondern dessen Schüler Ernst Klug, Leiter des Städischen Orchesters, dessen Konzertmeister Karl Neracher die Solopartie übernahm. Als Hartmann 1959 die Partitur überarbeitete, war er längst einer der meistgespielten Komponisten der jungen Bundesrepublik. Nicht zuletzt deswegen, weil er, ohne zu emigrieren, als „Unbelasteter“ den Nationalsozialismus überstanden hatte. Von dem Druck, unter dem er in jenen Jahren stand, ist im Concerto Funebre viel zu hören – aber mehr noch von der Autarkie, die sich Hartmann bewahrte.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das erste Programm, mit dem das Gürzenich-Orchester Köln nach dem Lockdown wieder vor dem Publikum auftrat, am 13., 14. und 15, September 2020 in der Kölner Philharmone. Dirigent war François-Xavier Roth, Solist Renaud Capuçon. Den hier besprochenen Werken ging die Uraufführung von Georg Friedrich Haas´ “hope” für Blechbläser und Pauke voraus.