Während sich Venedig von einer Seemacht in eine Luxusinsel verwandelt, wird hier Vivaldis „La verità in cimento“ uraufgeführt. Eine Reise ins Jahr 1720
Eine Brücke zum Festland gibt es noch nicht. Reisende von dort erreichen die Stadt im burcello, einem Schleppkahn für Passagiere, mit wimpelgeschmücktem Häuschen darauf, den ein Boot mit vier bis sechs Ruderern zieht, und wer zum ersten Mal kommt wie der Engländer Edward Wright im Dezember 1720, staunt, „eine so große Stadt, wie man Venedig wohl nennen kann, auf der Meeresoberfläche schwimmen zu sehen, Kamine und Türme zu erkennen, wo man nichts als Schiffsmasten erwarten würde.“ Masten freilich gibt es hier auch zu tausenden, aber eine Seemacht ist die Republik Venedig nicht mehr. Die Hochborder mit ihren gut hundert Kanonen, die im Arsenale gebaut werden, haben siebzehn Monate zuvor ihre letzte Schlacht geschlagen.
Im Juli 1718 haben die Türken in der Ägäis noch das venezianische Flaggschiff Trionfo in Brand geschossen, unnötigerweise. Der Friedensvertrag zwischen Österreich, Sultan Ahmed III. und der Republik Venedig ist da schon unterzeichnet, letztere bestätigt ihren Bedeutungsverlust nach Jahrhunderten mittelmeerischer Machtpolitik. Korfu, immerhin, bleibt den Venezianern, das hat der mit einer Stargage bezahlte Graf von der Schulenburg, ein taktisches Genie, 1716 noch gegen die Türken halten können, von Vivaldi mit einem Oratorium gewürdigt. Jetzt genießt der Niedersachse in einem gotischen Palast am Canal Grande einen rauschenden Lebensabend voller Gelage, Kunst und Musik, hochgeehrt, eines von vielen Originalen auf diesem steinernen Floß Venedig, das nun unkriegerisch am Rand der Weltgeschichte dümpelt.
Und zugleich am Ufer einer neuen Zeit. Es ist eine seltsame Stadt, in der am 26. Oktober 1720 Antonio Vivaldis Oper La verità in cimento ihre erste Aufführung erlebt. Die Türken und Österreicher, die sich anderswo weiterhin bekriegen, gehen hier spazieren, zwischen ihnen mehr und minder wohlhabende Touristen, junge Aristokraten aus ganz Europa auf ihrer Grand Tour, die seit dem späten 17. Jahrhundert als unerläßlich für die Ausbildung gilt – und für die Ausschweifung, besonders in dieser Stadt, deren fast sechs Monate dauernder Karneval auch ein Fest der Libertinage ist. Und der Opern, die hier an sieben Häusern gespielt werden. Mit einer unfassbaren Dichte von Instutitionen und Persönlichkeiten war Venedig die musikalischen Hauptstadt des 17. Jahrhunderts geworden, nun wird es zur Luxusinsel des 18. Jahrhunderts. 1720 leuchten hier abends erste Straßenlampen wie sonst nur in Paris und Wien.
Innenpolitisch sieht es finster aus. Eisern hält man fest an den mittelalterlichen Strukturen, an der Hierarchie der Nobili, die über Rat, Senat und den faktisch machtlosen Dogen bestimmen, ihrerseits wie alle scharf beäugt von den drei Staatsinquisitoren und ihrer allgegenwärtigen Geheimpolizei. Edward Wright, Gast von Lord Parker, betrachtet erstaunt die „klaffenden Mäuler“ in marmornen Masken, in die jeder Denunziant sein Briefchen werfen kann, er vermisst Stühle in den Cafés und erfährt, dass dadurch lange, also politische Gespräche unterbunden werden sollen. Auch hüten sich die Nobili geradezu panisch vor jedem Kontakt mit politischen Repräsentanten aus dem Ausland. Denn auch ein Nobile, der ins Visier der Staatspolizei gerät, kann schnell mal ohne Prozess in der Bleikammer oder gleich im Canal Orphano versenkt werden. Da hat sich nichts geändert, seit Antonio Vivaldi und der Dresdner Geiger Pisendel sich vier Jahre zuvor von Beschattern verfolgt sahen.
Kurtisanen nehmen an der Regatta teil
Der Adel trägt, mit schwerer Perücke, grundsätzlich langes Schwarz. Trifft ihn ein Bekannter niederen Standes, und sei es ein reicher Kaufman, tritt der zur Seite, verbeugt sich und murmelt „Eccellenza“. Auch die Nobildonne gehen in Schwarz, sofern sie überhaupt gehen und nicht in einer portatina getragen werden. Wie allen Venezianerinnen ist ihnen das Tragen von Schmuck, bis auf eine Goldkette, nicht erlaubt, anders als den Jüdinnen – und den cortigiane. Die Prostituierten sind ein massiver Wirtschaftsfaktor in Venedig, schon im 16. Jahrhundert wird ihre Zahl hier auf mehr als 11.000 geschätzt, ihnen wird sogar bei der jährlichen Festregatta ein corso delle cortigiane zugestanden. Sie sind überall, auch wenn das nicht jeder keusche Engländer merkt. Wright staunt über Vestalinnen ohne Schleier, die vorm Konvent mit Bekannten plaudern, perfekt frisiert, Hals und Brust mit dünnem Stoff „next to nothing“ verhüllt.
Tatsächlich gelten Venedigs Klöster als „äußerst libertin“, wie Sabine Hermann in einer Arbeit über „Käufliche Liebe im Venedig des 18. Jahrhunderts“ belegt. 1739 haben sogar drei Konvente darum gestritten, welches dem neuen Nuntius eine Geliebte liefern dürfe. Wo aber die Liebesdienerinnen Freiheiten genießen wie nirgends sonst, definiert man auch die Ehe etwas offener. Lord Chesterfield, der seine Grand Tour 1714 absolviert, empfiehlt später, in Venedig statt leichter Mädchen Damen der Gesellschaft zu frequentieren, die als besonders aufgeschlossen gelten. Der Cicisbeo, kavalieresker junger Hausfreund vornehmer Damen mit nicht weiter beredetem Aktionsradius, der sich noch in Mozarts Cherubino spiegelt, wird sogar Teil von Eheverträgen. Für männliche Bewohner und Besucher der Stadt gehört es sich sowieso, Affären zu haben.
So exotisch ist das Libretto also gar nicht, das Anfang Oktober 1720 mit dem „faccio fede“ der staatlichen Zensoren freigegeben wird und den Verwicklungen folgt, die sich ergeben, wenn ein Mann Kinder sowohl mit der Ehefrau als auch mit der Geliebten hat. Das und die Frage nach dem Machterhalt sind so eminent venezianische Themen, dass die Librettisten Giovanni Palazzi und Domenico Lalli sie gar nicht weit genug auslagern können: Nach Cambaja, ins Reich indischer Moguln, moslemischer Herrscher. Auf die Weise kann man auch ohne Verwerfungen die Polygamie jener Osmanen ins Spiel bringen, an die Venedig vor kurzem die griechische Halbinsel verloren hat – eine offenkundige „Türkenoper“ würde sich zur Stunde nicht empfehlen. Und schließlich lässt sich am Beispiel von Sultan Mahmud zeigen, dass ein Mann, der treuherzig alle Verhältnisse offenlegen will, nur Ärger kriegt und zur tragikomischen Figur verkleinert wird zwischen Intrigen, wie man sie in Venedig bestens kennt.
Der Konkurrenzdruck ist hier enorm. Als Wright die Stadt besucht, in der Saison von La verità in cimento, verzeichnet er sieben Opernhäuser, alle benannt nach den Kirchen, in deren Nähe sie stehen. Das älteste, San Cassiano, ist schon 1637 eröffnet worden, als das prächtigste und konservativste gilt das Teatro San Giovanni Crisostomo, seit 1678 in Betrieb. Hier könnte Edward Wright die Austattungsorgie erlebt haben, die ihn – der aus London ja einiges gewöhnt ist – schwer beeindruckt: Nero und Gemahlin werden auf gewaltigem Thron von einem Elefanten hereingezogen, der Kopf, Augen und Rüssel „as if alive“ bewegt. Während sich dann der Thron zu einem Amphitheater auseinanderfaltet, zerfällt der Elefant, und seinem Bauch entsteigen Gladiatoren in voller Rüstung.
Das Sant`Angelo direkt am Canal Grande hat es nie ganz leicht gehabt, auch nicht während Vivaldis kurzer Zeit als Impresario des Theaters. Fünf seiner bislang zwölf Opern sind hier uraufgeführt worden, die dreizehnte soll seinen Wiedereinstieg in die Szene sichern, nachdem er drei Jahre lang Kapellmeister in Mantua war. Fast alle Nummern hat er eigens für diese Oper neu komponiert. Sein Name ist in Venedig freilich auch so schon ein Begriff; selbst der nur begrenzt musikaffine Reisende Wright nennt den „famous Vivaldi (whom they call the Prete rosso)“, spricht von ihm aber nur als musizierendem Priester früherer Jahre. Tatsächlich verdankt der Musiker den Ruhm in der Stadt seiner Geburt auch seiner Tätigkeit als Geigenlehrer, künstlerischer Leiter und Komponist am „Ospedale della Pietà“, einer legendären Institution.
Nicht zuletzt ist dieses „Hospital“, eines von vier großen Fürsorgezentren in der Stadt, die karitative Antwort auf die Folgen nichtehelicher Verbindungen. Es verfügt über eine Babyklappe und nimmt ausschließlich Mädchen auf – „generally bastards“, wie Wright anmerkt. An die tausend Zöglinge sind hier, an der Riva degli Schiavoni, untergebracht, von denen die musikalisch begabten als figlie di coro zu Sängerinnen und Instrumentalistinnen von höchster Qualität ausgebildet werden, den besten Profis Europas auch als Solisten ebenbürtig. Ihre Auftritte – im Ospedale hinter eisernen Gittern, soviel Mittelalter muss sein – sind eine Einnahmequelle und Teil eines Musiklebens, das in Venedig auch außerhalb des Karnevals und der Oper omnipräsent ist: In den Kirchen, den privaten Palästen, den Gran Scuole der Zünfte, auf dem Wasser.
Aber erst im Karneval, der im Oktober beginnt, kommt alles zusammen, treffen sich erotische Entfesselung und Musiktheater. Es sei, staunt Wright, als begrüße man hier die Sonne nach der Polarnacht. Die meisten, Männer wie Frauen, Patrizier wie Pöbel und natürlich die Besucher, tragen nun tagsüber den Tabarro und die Bautta: Ein bis übers Knie reichendes schwarzes, mantelartiges Gewand, und eine den Kopf umschließende schwarze Seidenkappe unter schwarzem Dreispitz, dazu eine weiße Halbmaske mit schnabelartig vorspringender Nase. Je weiter die Saison voranschreitet, desto bunter maskiert man sich: Frauen als Nymphe und Schafhirtin, Männer als Pulcinello und Pantalone, ebenso aber Frauen als Männer und umgekehrt. Das alles erleichtert auch intime Treffen, für die nicht zuletzt die Opernlogen mit Vorhängen geeignet sind.
Aus den Logen wird ins Parkett gespuckt
„Es gibt hier keine offenen Ränge wie in London“, wundert sich Edward Wright. Der Zuschauerraum sei von unten bis oben in Logen aufgeteilt, in die jeweils an die sechs Personen passen. Das tief eingewurzelte Bedürfnis der eng beieinander lebenden Venezianer nach Diskretion und Abgeschlossenheit kommt hier der Lust entgegen und macht die Staatsinquisitoren nervös, deren Spitzel hier den Überblick verlieren; Insider Giacomo Casanova empfiehlt noch 1780, im Theater für bessere Beleuchtung zu sorgen, damit die Prostituierten nicht sogar dort ihrer Arbeit nachgehen könnten. Doch was der reisende Engländer Wright eine „skandalöse Sitte“ nennt, ist etwas anderes: Aus den oberen Logen wird während der Vorstellung ins Parkett hinab gespuckt, man wirft mit Obstschalen, und nicht selten trifft es Besucher von Rang.
Denn auch die begeben sich aus ihren Logen gern nach unten. Manche, um den Sängern näher zu sein, die meisten aber, so Wright, um herauszufinden, wer sich hinter dieser und jener Maske verbirgt. Dann gibt es da noch Kunstfreunde, die, Wachskerzen in der Hand, das gedruckte Libretto mitlesen, solange nicht eine der „Gefälligkeiten von oben“ ihnen die Flamme auslöscht. Roheit und Raffinesse, Regelstrenge und Entfesselung sind Nachbarn in Venedig. Noch weitaus unruhiger wird es während der Intermezzi comici, den komischen Einlagen, mit denen sich vor allem kleinere Opernhäuser wie das San Moisé und das Sant´Angelo Kundschaft abzujagen versuchen. Ein Komikerpaar singt, lacht und blödelt da zur Musik einer Minioper. In Vivaldis La Veritá in cimento wird L´avaro eingebaut, offenbar ein totaler Flop, der sofort nach der Premiere verschwindet und wohl auch den Erfolg der Oper selbst beschädigt.
Das trifft sich verheerend mit einer Satire, die, perfekt getimt, kurz nach der Premiere erscheint, anonym verfasst von einem Sproß der ältesten Familien der Stadt, dessen Verfasserschaft freilich nicht nur die Zensoren kannten, die Il teatro alla moda freigegeben hatten. Benedetto Marcello, 24 Jahre alt, als Nobile ein Ratsmitglied, selbst Komponist und Autor, steht der Moderne verächtlich gegenüber. Seiner Familie gehört nicht nur ein Teil des Grundstücks, auf dem das Sant`Angelo steht, sondern auch eine Loge, um deren Benutzung Benedetto einen langen Rechtsstreit mit seinem älteren Bruder Alessandro führt. Bestens vertraut mit Tradition und Alltag des Opernbetriebs, verwöhnt, konservativ und zynisch, brillant und unfair, nimmt Benedetto mit Hilfe leicht entzifferbarer Anspielungen den europaweit bekannten Vivaldi und sein Team aufs Korn.
Er empfiehlt in grotesken Übertreibungen genau das, was er ablehnt, etwa ausgedehnte Verzierungen. „Kommen in Arien Substantive vor, wie Vater, Herrschaft, Liebe, Arena, Königreich, Stärke, Herz etc. etc. […], unterlege der moderne Komponist diese mit möglichst langen Koloraturen, z.B. Vaaaa… Herrschaaaaa… Liiiiee…“ Von der Motorik über die Harmonik bis zur Dynamik beschreibt er Vivaldis Stil ex negativo, und diese Kritik ist diabolisch verschränkt mit der an Eitelkeiten, Schlampereien, Intrigen, ruinösen Gagen und penetranten Primadonnenmüttern, die den Opernbetrieb bis heute begleiten. Es fehlt nicht einmal der Seitenhieb auf Gastronomen, deren Schokolade „aus Zucker, falschem Zimt, Mandeln, Eicheln und unbehandeltem Kakao“ besteht.
Da wehen uns venezinianische Aromen entgegen, auf die Antonio Vivaldi vorerst lieber verzichtet. Zu einer weiteren Premiere im Dezember steuert er nur einen Akt bei, die Arbeit an einer dritten Oper bricht er ab und besteigt den burcello zum Festland. Seine nächsten Opern kommen in Mailand und Rom heraus, mit Venedig riskiert es Vivaldi erst fünf Jahre später erneut. Sein junger Widersacher Benedetto Marcello aber verliebt sich unstandesgemäß in eine Gesangsschülerin, die er heiratet – heimlich, um seine Ämterlaufbahn nicht zu gefährden. Venedig, eine Oper? Man kann sie hören, diese Oper. Zynismus zwischen den Epochen, Überdruck auf engem Raum, Spannung zwischen großem Gefühl und schneller Ironie – das ist La verità in cimento.
Dieser Text erschien im Mai 2015 im Magazin der Zürcher Oper (MAG 29, S. 12-17) und ist urheberrechtlich geschützt. Eine kürzere Fassung erschien im Programmheft zu „La verità in cimento“, Premiere am 25. Mai 2015.
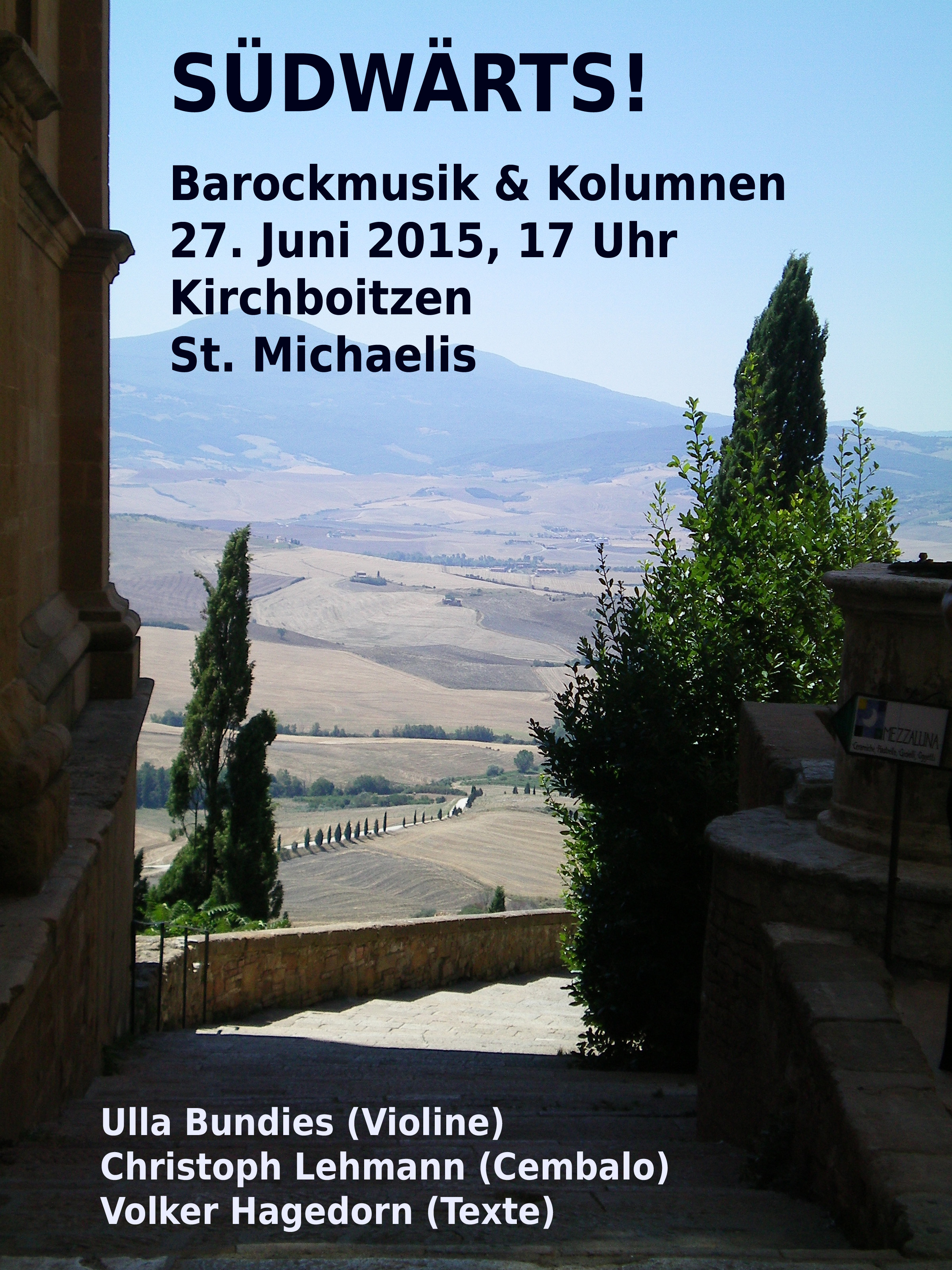 > Noch mehr Süden: Für das Magazin der Oper Zürich habe ich das libertäre, zynische und immer noch auch mittelalterliche Venedig des Jahres 1720 erkundet, die Stadt, in der Antonio Vivaldis 13. Oper “La verítà in cimento” uraufgeführt wurde. Die Züricher Version in der Regie von Jan Philipp Gloger, die am 25. Mai Premiere hatte, geht so: Eine wohlhabende Familie zerlegt sich selbst, weil Papa endlich mal mit seiner Lebenslüge aufräumen will. Alles ist in leichter Karikatur so klar gezeichnet, dass man eine ganze Gesellschaftsschicht erkennt: Etliche Paare um die 60 im Zürcher Opernpublikum hätten Modell stehen können für einen sich vieles (auch einen Porsche) erlaubenden Unternehmer und seine der Esoterik zugeneigte Ehefrau. Finale Folgen der Wahrheitsliebe: Der Alte, mit Gartenschlauch an seinen Stuhl gefesselt, blickt im verwüsteten Arbeitszimmer auf die Leiche seines nichtehelichen Sohns, den dessen Verlobte gerade erschossen hat, welche sich im Korridor nun selbst die Kugel gibt, während die Exgeliebte des Patriarchen sich im Wohnzimmer in einem Weinkrampf auf dem Boden wälzt und seine Ehefrau sich zwischen Möbeln einen Zen-Hain gebastelt hat, wo sie wirren Sinns im Lotussitz vor sich hinstarrt. Das alles passt bestens zur Musik von „La verità in cimento“. Dialog zweier feiner älterer Damen danach, vor dem Opernhaus: „Ein schönes Erlebnis!“ „Ja! Der Schluss war etwas überraschend.“
> Noch mehr Süden: Für das Magazin der Oper Zürich habe ich das libertäre, zynische und immer noch auch mittelalterliche Venedig des Jahres 1720 erkundet, die Stadt, in der Antonio Vivaldis 13. Oper “La verítà in cimento” uraufgeführt wurde. Die Züricher Version in der Regie von Jan Philipp Gloger, die am 25. Mai Premiere hatte, geht so: Eine wohlhabende Familie zerlegt sich selbst, weil Papa endlich mal mit seiner Lebenslüge aufräumen will. Alles ist in leichter Karikatur so klar gezeichnet, dass man eine ganze Gesellschaftsschicht erkennt: Etliche Paare um die 60 im Zürcher Opernpublikum hätten Modell stehen können für einen sich vieles (auch einen Porsche) erlaubenden Unternehmer und seine der Esoterik zugeneigte Ehefrau. Finale Folgen der Wahrheitsliebe: Der Alte, mit Gartenschlauch an seinen Stuhl gefesselt, blickt im verwüsteten Arbeitszimmer auf die Leiche seines nichtehelichen Sohns, den dessen Verlobte gerade erschossen hat, welche sich im Korridor nun selbst die Kugel gibt, während die Exgeliebte des Patriarchen sich im Wohnzimmer in einem Weinkrampf auf dem Boden wälzt und seine Ehefrau sich zwischen Möbeln einen Zen-Hain gebastelt hat, wo sie wirren Sinns im Lotussitz vor sich hinstarrt. Das alles passt bestens zur Musik von „La verità in cimento“. Dialog zweier feiner älterer Damen danach, vor dem Opernhaus: „Ein schönes Erlebnis!“ „Ja! Der Schluss war etwas überraschend.“