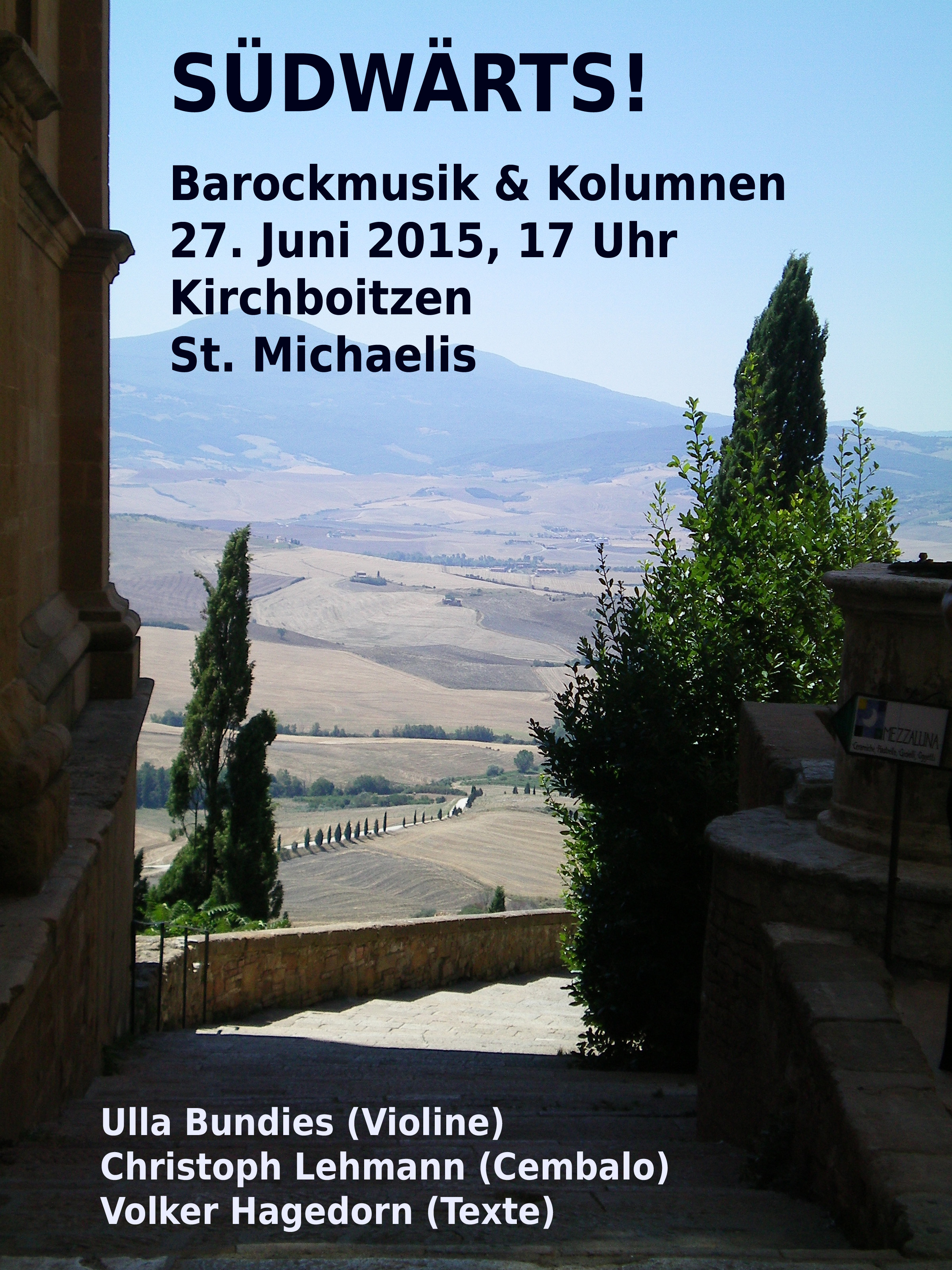 > Noch mehr Süden: Für das Magazin der Oper Zürich habe ich das libertäre, zynische und immer noch auch mittelalterliche Venedig des Jahres 1720 erkundet, die Stadt, in der Antonio Vivaldis 13. Oper “La verítà in cimento” uraufgeführt wurde. Die Züricher Version in der Regie von Jan Philipp Gloger, die am 25. Mai Premiere hatte, geht so: Eine wohlhabende Familie zerlegt sich selbst, weil Papa endlich mal mit seiner Lebenslüge aufräumen will. Alles ist in leichter Karikatur so klar gezeichnet, dass man eine ganze Gesellschaftsschicht erkennt: Etliche Paare um die 60 im Zürcher Opernpublikum hätten Modell stehen können für einen sich vieles (auch einen Porsche) erlaubenden Unternehmer und seine der Esoterik zugeneigte Ehefrau. Finale Folgen der Wahrheitsliebe: Der Alte, mit Gartenschlauch an seinen Stuhl gefesselt, blickt im verwüsteten Arbeitszimmer auf die Leiche seines nichtehelichen Sohns, den dessen Verlobte gerade erschossen hat, welche sich im Korridor nun selbst die Kugel gibt, während die Exgeliebte des Patriarchen sich im Wohnzimmer in einem Weinkrampf auf dem Boden wälzt und seine Ehefrau sich zwischen Möbeln einen Zen-Hain gebastelt hat, wo sie wirren Sinns im Lotussitz vor sich hinstarrt. Das alles passt bestens zur Musik von „La verità in cimento“. Dialog zweier feiner älterer Damen danach, vor dem Opernhaus: „Ein schönes Erlebnis!“ „Ja! Der Schluss war etwas überraschend.“
> Noch mehr Süden: Für das Magazin der Oper Zürich habe ich das libertäre, zynische und immer noch auch mittelalterliche Venedig des Jahres 1720 erkundet, die Stadt, in der Antonio Vivaldis 13. Oper “La verítà in cimento” uraufgeführt wurde. Die Züricher Version in der Regie von Jan Philipp Gloger, die am 25. Mai Premiere hatte, geht so: Eine wohlhabende Familie zerlegt sich selbst, weil Papa endlich mal mit seiner Lebenslüge aufräumen will. Alles ist in leichter Karikatur so klar gezeichnet, dass man eine ganze Gesellschaftsschicht erkennt: Etliche Paare um die 60 im Zürcher Opernpublikum hätten Modell stehen können für einen sich vieles (auch einen Porsche) erlaubenden Unternehmer und seine der Esoterik zugeneigte Ehefrau. Finale Folgen der Wahrheitsliebe: Der Alte, mit Gartenschlauch an seinen Stuhl gefesselt, blickt im verwüsteten Arbeitszimmer auf die Leiche seines nichtehelichen Sohns, den dessen Verlobte gerade erschossen hat, welche sich im Korridor nun selbst die Kugel gibt, während die Exgeliebte des Patriarchen sich im Wohnzimmer in einem Weinkrampf auf dem Boden wälzt und seine Ehefrau sich zwischen Möbeln einen Zen-Hain gebastelt hat, wo sie wirren Sinns im Lotussitz vor sich hinstarrt. Das alles passt bestens zur Musik von „La verità in cimento“. Dialog zweier feiner älterer Damen danach, vor dem Opernhaus: „Ein schönes Erlebnis!“ „Ja! Der Schluss war etwas überraschend.“
P.S. In der vorigen Kolumne fehlte eine Null. „Alle fünfhundert Jahre gelingt es“, so zitierte ich dort aus dem Kopf Richard Wagner, die Einzigartigkeit seiner Ehe mit Cosima betreffend. Ein kundigerer Leser hat mich darauf hingewiesen, dass Wagner sogar von 5000 Jahren sprach. Darunter mache er es eben nicht. Die Verbindung dieser Lichtgestalten ist demnach nur mit der Geburt Jesu, der Zähmung des Feuers oder der Mondlandung zu vergleichen. Man kann zum vermehrten Mal den Kopf schütteln über Richard, dessen Größe vielleicht doch von seinem Größenwahnsinn übertroffen wird, sollte sich stattdessen aber mal Hans von Bülow zuwenden, den Wagner von Cosima befreite: Am 10. Juni vor 150 Jahren dirigierte er in München die Uraufführung von „Tristan und Isolde“.