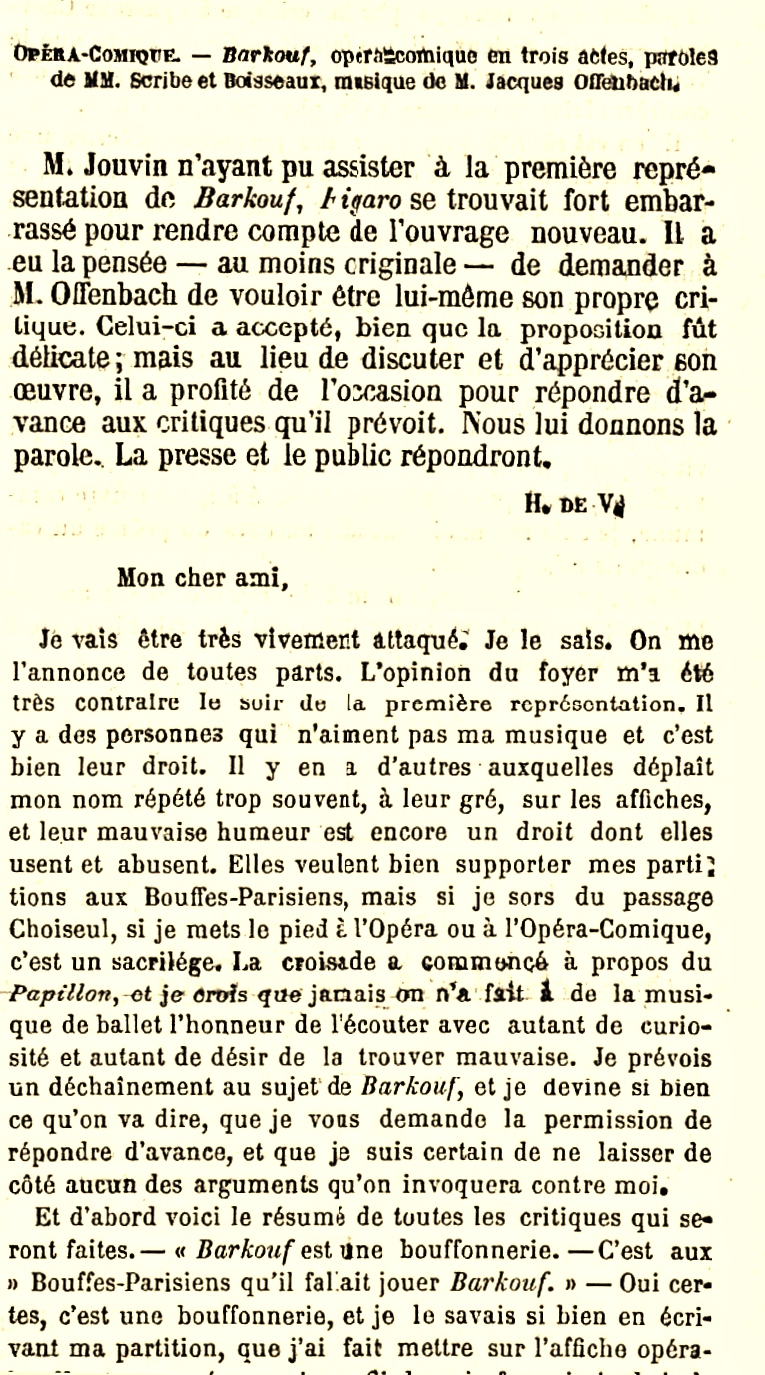Wie Jacques Offenbach auf dem Weg zur Oper zwischen alle Stühle geriet: Umgebung, Entstehung und Unterdrückung eines Meisterwerks

Vom einen Theater zum anderen, von den Bouffes-parisiens bis zur Opéra-Comique geht man acht Minuten, immer noch. Doch vieles hat sich geändert. Der Jacques Offenbach des Jahres 1860 wäre überrascht, eine Rue du 4 Septembre überqueren zu müssen. Die ist auch 1866 noch nur zart eingezeichnet unter die Linien der Vermesser, die im Auftrag des Präfekten Haussmann den bis dahin präzisesten Plan von Paris vorlegen und ebenso zart die Schneise der geplanten Avenue de l´Opéra skizzieren. Unbedroht bleibt ein schraffiertes Quadrat an der Passage Choiseul: „Bouffes-parisiens“. Eine Institution, nicht wegzudenken, nicht einmal von Baron Haussmann. Mit diesem Theater unfern der Seine ist Jacques Offenbach berühmt geworden, seit er es 1855 gründete.
Aber seine Träume, seine Visionen gehen nicht erst 1860, dem Jahr von Barkouf, über das Milieu unterhaltsamer Komik hinaus. Die große Bühne, das Theater als Repräsentationsort des Bürgertums, hat er schon bald kennengelernt, nachdem er 1833 mit Vater und Bruder aus Köln nach Paris zog, in die Hauptstadt einer Nation, in der Juden nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden, ins Zentrum der europäischen Musikwelt. Schon mit fünfzehn Jahren sitzt der flammend Begabte als Cellist im Orchester der Opéra Comique in der Salle Favart, spielt Werke von Boieldieu, Auber, Mozart, Rossini und nimmt Unterricht beim Opernkomponisten Fromental Halévy.
Die Salle Favart jener Jahre ist wenig später abgebrannt und durch ein prachtvolles Gebäude am selben Platz ersetzt worden, das man für feuersicher hält (ein Irrtum, dem sich die 1898 eröffnete dritte Salle Favart verdankt). Und diese Institution behält Offenbach im Sinn, während er als Cellist in Salons und als Komponist mit Tanzmusik reüssiert. Das bleibt auch so nach dem beispiellosen Erfolg seines Orphée aux enfers, der nach der Uraufführung 1858 ganze 227 Mal in Folge gespielt wird. Als Genie doppelbödiger Buffonerie ist der 41-jährige eine Größe über Paris hinaus in jenem Sommer 1860, als sich der frisch installierte Intendant der Opéra-Comique an ihn wendet. Eine Oper von vier Akten wird gewünscht, der Entwurf eines Libretto liegt vor. Endlich!
Es muss wieder Schwung in die Bude
Das renommierte Haus, mit umgerechnet jährlich rund zwei Millionen Euro subventioniert, hat in den 1850ern ein wenig sein Profil verloren, die Leichtigkeit und Heiterkeit der Sujets. Selbst Giacomo Meyerbeers Étoile du Nord ist dort gespielt worden, eigentlich eine Grand opéra, mit einem Minimum gesprochener Dialoge als opéra-comique maskiert. Der von den britischen Kulturtouristen viel gelesene New Paris Guide der Brüder Galignani stellt in der Ausgabe von 1860 fest, man folge an der Opéra-Comique inzwischen „einem elaborierteren, vielleicht auch gelehrten Stil, aber weniger populär“. Gut möglich, dass Intendant Alfred Beaumont da in seiner ersten Spielzeit gegensteuern will mit einem wie Offenbach. Auf bewährter Basis freilich: Librettist Eugène Scribe, jetzt 68 Jahre alt, schrieb nicht nur für die Blockbuster von Meyerbeer, von Robert le diable bis zu Le prophète, dazu fast alle Opern von Auber – er beherrscht jedes Genre und eine ganze Textfabrik.
Nach Scribes Plan hat ein junger Autor Le Sultan Barkouf geschrieben, eigentlich für den Komponisten Clapisson und für das innovative Théatre Lyrique. Weil dort nichts daraus wird, bekommt Offenbach den kuriosen Text, halb Drama, halb Politsatire. Barkouf heißt der Hund, den ein Willkürherrscher als Gouverneur einsetzen lässt. Damit sollen die aufsässigen Bewohner einer Stadt gedemütigt werden, die exotisch Lahore heißt, aber dem Paris des Zweiten Kaisrreichs kaum ferner ist als Offenbachs Orphée. Der neue Statthalter ist naturgemäß sehr bissig, bis seine frühere Herrin auftaucht, die Marktfrau Maïma. Ihr frisst er aus der Hand, sie wird zur Dolmetscherin ernannt und interpretiert Barkoufs Gebell im Sinne der Opposition. Die Steuern werden gesenkt, Todesurteile kassiert. Am Ende ist zwar der Hund in einer Schlacht gefallen, doch der Mogul muss die neuen Verhältnisse legitimieren.
Das ist nicht unbedingt ein staatsgefährdender Stoff neben Orphée, wo zum kurz aufblitzenden Beginn der verbotenen Marseillaise Göttervater Jupiter sich anhören muss, sein Regime sei stumpfsinnig, und nur der „Öffentlichen Meinung“ wegen den „schönen Schein“ wahrt. Indessen sind solche Stacheln längst zur pikanten Würze eines Kassenschlagers geworden, dem Kaiser Napoléon III. und Kaiserin Eugénie im April 1860 höchstpersönlich in einer Sondervorstellung im Théatre-Italien beigewohnt haben. Dass die politische Wetterlage sich unterdessen wandelt, merkt Offenbach erst später.
Dem Starlibrettisten passen die Änderungen nicht
Zunächst trifft er bei der Arbeit am Barkouf auf Probleme, die im Theater Alltag sind. Es gibt eine Starsopranistin, Delphine Ugalde, die der Tragweite einer Rolle wie der Maïma nicht ganz gewachsen ist, und so bittet er Scribes Mitarbeiter, einer weiteren Frauenrolle mehr Gewicht zu verleihen, der Apfelsinenverkäuferin Balkis. Scribe tobt, als er von diversen Änderungen erfährt. „Das hat keine Einheit mehr, keine Linie. Das sind Szenen, das ist kein dramatisches Werk mehr!“ Vielleicht spürt er auch, dass Zeiten in der Kunst anbrechen, die nicht mehr seine sind. Um den Spannungsbogen zu retten, arbeitet er selbst die letzten beiden Akte zu einem um. Dass er, Kommandeur der Ehrenlegion, auch noch Ärger mit der Zensur bekommen könnte – damit rechnet er wohl nicht.
Im selben Sommer ist das Abenteuer außer Kontrolle geraten, auf das sich Napoléon III. im Vorjahr eingelassen hat, mit gleich mit 170.000 Soldaten zur Befreiung des Piemont von österreichischer Herrschaft. Inzwischen will ganz Italien die Einigkeit. Am 10. Mai ist der Revolutionär Garibaldi mit tausend Rothemden in Marsala gelandet, am 20. Juli ist ganz Sizilien in seiner Hand, Anfang August auch Neapel, womit das „Königreich beider Sizilien“ endet. Nun sieht sich der römische Kirchenstaat bedroht, dem Napoléon III. verpflichtet ist. Der 52 Jahre alte Franzosenkaiser, mit einem einigen Italien sympathisierend, agiert halbherzig , als „schwacher Cäsar“, der allzu viele Parteien bei Laune halten will. Die Unterstützung der französischen Katholiken bröckelt.
Dieser Regierungschef, der von allem etwas ist, Kapitalist und Sozialist, Katholik und Aufklärer, Liberaler und Autoritärer, gerät von allen Seiten unter Druck. Er reagiert durch vorsichtiges Entgegenkommen. Ein Dekret wird vorbereitet, das dem Corps législatif, bis dahin die Karikatur eines Parlaments, mehr Spielraum verschaffen soll. Umso energischer agiert er in Ostasien, wo sich Frankreich im „Zweiten Opiumkrieg“ einer britischen Militäroperation gegen China anschließt. Anfang Oktober 1860 fällt die vereinte Streitmacht in Peking ein. Bei einer beispiellosen Plünderung werden 3000 Chinesen umgebracht, der kaiserliche Sommerpalast wird niedergebrannt.
Während das geschieht, brüten in Paris die Zensoren des Staatsministers über solchen Zeilen einer Bühnenfigur: „Kriecht alle vor mir! So ist’s gut! (…) Ich werde einige Tage in den Königreichen von Kaschmir und Kandahar gebraucht… zwei aufständische Städte, die ich einnehmen und niederbrennen werde… es dauert nicht lange. Ich komme zurück, und wehe dem, der die Autorität des neuen Vizekönigs [der Hund Barkouf] nicht geachtet hat!“
Verspottung staatlicher Autorität? Zensiert.
„Die Autoren (…) haben ohne Zweifel geglaubt, von den Bedenklichkeiten dieses bizarren Sujets und den Anspielungen, von denen es wimmelt, durch die possenhafte Form des Werks und die Verlegung des Schauplatzes nach Indien, das Land der Fabeln und der Fantasie, abzulenken. Der Milderungen bewusst, die aus diesen Umständen resultieren können, kommen wir jedoch nicht umhin, im Hintergrund des Stücks, den ihm innewohnenden Details und deren unvermeidbarer Umsetzung auf der Bühne die fortwährende Verspottung aller staatlichen Autorität in jeglicher Zeit, in jeglichem Land zu erkennen. Dem folgend können wir eine Genehmigung zur Aufführung des Sultan Barkouf nicht befürworten…“ Dieses Schreiben vom 10. Oktober 1860 enthält zugleich ein Aufführungsverbot durch Staatsminister Comte Walewski.
Freilich haben da die Proben schon begonnen. Und sie werden auch nicht gestoppt. Offenbachs Biograph Jean-Claude Yon geht davon aus, dass Intendant Beaumont dem Minister das drohende finanzielle Desaster klar machte und darum eine entschärfte Fassung vorlegen durfte. Die kosmetischen Eingriffe ändern aber nichts Wesentliches – der Hund etwa wird vom „Vizekönig“ zum „Gouverneur“ degradiert, die ganze Oper von der „comique“ zur „bouffe“. Vom Zensorentrio wird das am 28. November so merklich zähneknirschend durchgewinkt, dass man eine Weisung von ganz oben spürt. Wohl kaum vom Minister, sondern vom Halbbruder des Kaisers, dem Präsidenten des Parlaments. Nur einer wie der Herzog von Morny, Bewunderer Offenbachs und unter Pseudonym auch dessen Librettist, konnte eine so verfahrene Lage retten.
Morny hatte den Staatsstreich seines Halbbruders 1851 mitinszeniert und war dann zum Präsidenten des corps législativ ernannt worden. 150 Senatoren und 270 Abgeordnete führt der 49-jährige nun an, und zum Leidwesen des Kaisers trägt er gern eine Hortensie im Knopfloch, die auf seine (uneheliche) Abkunft von Hortense de Beauharnais verweist, der Mutter Napoleons III. Charles-Auguste Morny ist ein so skrupelloser wie offener Geist, der wohl auch hinter dem liberalen Dekret steckt, das am 24. November 1860 verabschiedet wird, ein jovialer Mephisto mit Sinn für die Kunst, der neben Offenbach auch die Tochter der eigenen Geliebten fördert – aus ihr wird die Schauspielerin Sarah Bernardt.
Während man die Uraufführung, zuerst für den 26. November annonciert, weiter und weiter nach hinten schiebt, stellt sich heraus, dass Delphine Ugalde wegen einer Schwangerschaft nicht wird singen können – die Rolle passte ihr ohnehin nicht. Am 11. November wird Mademoiselle Saint-Urbain als neue Maïma bekanntgemacht, drei Wochen später zieht sie sich wegen einer Halsentzündung zurück, falls es denn eine ist und nicht eher die Sorge, es könne mit Barkouf noch Ärger geben. Jacques Offenbach kann sich derweil damit trösten, dass er den Sprung ins größte Opernhaus der Stadt geschafft hat, die Salle Peletier, zur Zeit Académie Impériale de Musique, 1800 Plätze. Hier wird am 26. November Papillon uraufgeführt, ein Ballett in zwei Akten, glänzend besetzt und besucht.
Noch ein Problem: Richard Wagner und sein Tannhäuser
Im selben Haus plagt man sich schon seit Ende September mit Proben zur Oper eines Deutschen, deren Produktion Napoléon III. selbst angeordnet hat – Tannhäuser von Richard Wagner, einem Mann, der sich in Paris inzwischen weitgehend unbeliebt gemacht hat. Dass freilich sogar Wagner noch zum Problem für Barkouf werden könnte, dürfte Offenbach sich nicht träumen lassen. Weniger überraschend ist für ihn vermutlich, dass der Erfolg seines Balletts (das mit 42 Vorstellungen den Tannhäuser in dieser Spielzeit bequem hinter sich lassen wird) auch den Antisemitismus zum Vorschein bringt, mit dem sich schon Meyerbeer auseinandersetzen musste. Offenbach sei, so Paul Scudo in der Revue des Deux Mondes, „aus der semitischen Rasse geboren (…), deren fatale Prägung er erhalten hat.“ Man erlebe in Papillon die „Flachheit und Nichtigkeit“ einer „Gauklermuse, die auf der bedeutendsten Opernbühne Europas herumtollt.“ Dieser Jude und Clown, so lässt sich das lesen, soll gefälligst zufrieden sein mit seinem Theaterchen an der Passage Choiseul.
Aber am 24. Dezember 1860 findet sie statt, die première répresentation von Barkouf, am Montagabend vor der Mitternachtsmesse, mit der in Frankreich das Weihnachtsfest beginnt. 1500 Plätze hat die Salle Favart, deren Logen sogar über Klingelschnüre verfügen, um Kellner herbeirufen zu können. Der Abend, von Jacques Offenbach selbst dirigiert, wird keineswegs ein Fiasko. Man weiß die aufwändigen Kostüme und Kulissen zu schätzen, und drei Nummern müssen wiederholt werden. Pfiffe hört nur Paul Scudo. Doch nicht nur sein Urteil scheint schon vorher gefällt zu sein. Einer der klügsten Kritiker tut im Journal des Débats den Dreiakter als Stümperei eines Possenreißers ab, dessen Namen er in neun (!) Spalten kein Mal nennt. Hector Berlioz ist als Komponist selbst ein Erneuerer. Doch was Offenbach hier unternimmt, empört ihn.
Elf Takte lang spielen einmal die Geigen in der Ouvertüre rasend schnelle Achtel, g und f, schon das hat Berlioz geärgert, „ein Summen vergleichbar dem von Wespen, die man in ein Glas gesperrt hat“. Dass Dur und Moll sich kreuzen, dass von B-Dur direkt in einen G-Dur-Sextakkord gesprungen wird, „all das lässt sich ohne Zweifel machen, aber mit Kunstfertigkeit. Hier wird es mit einer Nachlässigkeit, einem Unkundigsein der Gefahren vorgeführt, das ohne Beispiel ist. Man denkt dabei an das Kind, das einen Knallkörper in den Mund steckt und wie eine Zigarre rauchen will.“ Und dann erweitert Berlioz die Perspektive: „Ganz entschieden geht es verrückt zu in den Hirnlein gewisser Musiker. Der Wind, der durch Deutschland weht, macht sie wahnsinnig… Ist die Zeit nahe? Welchem Messias geht der Autor von Barkouf als Johannes der Täufer voraus?“
Diese Anspielung versteht jeder – Berlioz meint Wagner. Auch Oscar Commentant sieht in L´Art musical Offenbach als Teil einer anstehenden deutschen Invasion: „Das neue Werk von M. Offenbach wimmelt von harmonischen Exzentrizitäten, die die missgestimmten Apostel der Zukunftsmusik nicht verleugnen.“ Eine „Melange aus Scharlatanerie und Narrheit“ sei typisch für „den deutschen Genius“, der sein Ideal „jenseits eines tobenden Ozeans falscher Noten und nervtötender Modulationen“ erblicke. Das ist das Vokabular, mit dem sich inzwischen die Pariser Presse auf Richard Wagner eingeschossen hat. Unversehens wird Offenbach als deutscher Vasall eines Komponisten angegriffen, dem er nicht ferner sein könnte. Seine Parodie Wagnerscher „Zukunftsmusik“ wird immer noch gespielt, im vergangenen April auf kaiserliches Geheiß sogar als Teil einer Gala, einen Monat, nachdem der Regent die Produktion des Tannhäuser befohlen hatte (Napoléon III. scheint zwischen den musikalischen Fraktionen ebenso zu lavieren wie in der Politik).
„Ja, sicher, es ist eine Bouffonerie.“
Vor allem aber darüber, dass Offenbach niemals seine Bouffes-parisiens hätte verlassen dürfen, sind sich die Kritiker mit einer Vehemenz einig, auf die der Komponist selbst schon am 30. Dezember 1860 im Figaro antwortet: „Ja, sicher, es ist eine Bouffonerie.“ Genau das Leichte, Heitere habe der Opéra-Comique ja zuletzt gefehlt. „Ich verteidige das Genre, dem ich treu bleiben will. Hätte ich es verlassen, dieselben Personen, die jetzt meine Heiterkeit tadeln, hätten gesagt: ,Voilà, jetzt verirrt er sich ins Lyrische! Ah! Welchen Erfolg er gehabt hätte, wäre er bei seinem bescheidenen Handwerk geblieben.‘“
Wohl wahr, doch er macht er seine Partitur harmloser, als sie ist. Offenbach geht in Richtung der großen Oper und lässt sie zugleich hinter sich. Er bietet eine erstaunliche Mischung aus Witz und Melancholie, von traurigem Lächeln springt er zu wahnwitzigem Übermut. Beiläufig wirft er chromatische Modulationen hin, in denen ein Tristanakkord nicht auffiele, zugleich Melodien, die man immer wieder hören möchte. Diese Couplets, Duos, Ensembles, Chöre sind subtiler komponiert, enger aufeinander bezogen als in Orphée. Offenbach liefert auch Randbemerkungen wie die der Goncourts, knapp und genau, Blicke auf die Straße. Seine Doppelbödigkeit ist nicht mehr nur komisch.
Die Ambivalenz des Barkouf scheint viele Begleitumstände zu spiegeln – eine Stadt als Dauerbaustelle, ein verunsichertes Regime, ein Librettist, dessen Tage gezählt sind, während die Opernkonventionen bröckeln. Barkouf weiß zu viel davon, dieser Hund muss begraben werden. Nach der siebten Vorstellung am 16. Januar wird das Stück abgesetzt, trotz passabler Einnahmen. Die „Gendarmen der Ästhetik“ (so Xavier Aubryet im Figaro jener Tage) haben gesiegt, Offenbach braucht nicht mehr die acht Minuten von der Passage Choiseul bis zur Salle Favart zu gehen; die Partitur bleibt 150 Jahre lang verschwunden. Wir können sie nun betrachten wie den Pariser Stadtplan von Haussmann, wo zwischen den Linien der Gegenwart schon die Zukunft Gestalt annimmt.
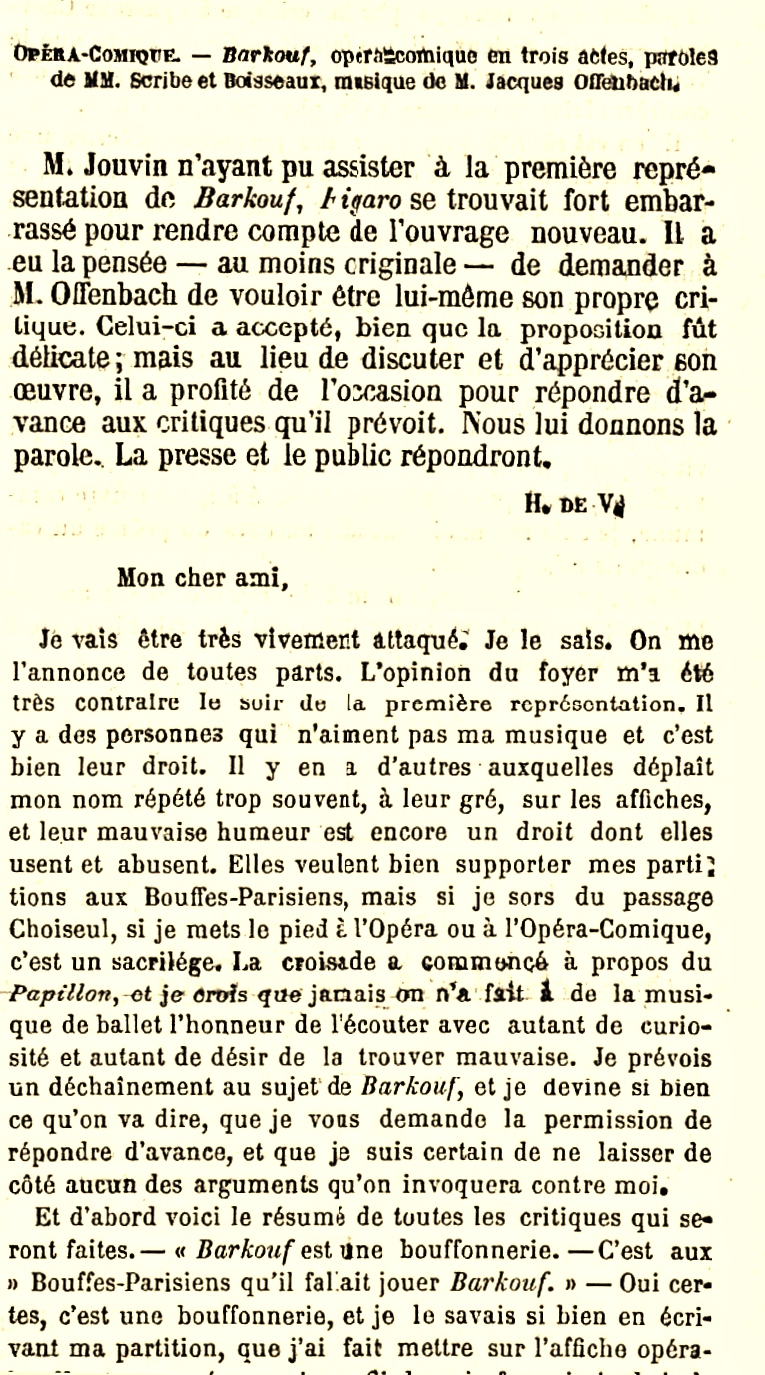
Kartenausschnitt: Plan général de la Ville de Paris et de ses environs, 1866. Zeitungsausschnitt: Figaro, 30. Dezember 1860. Einigen Zeilen, in denen der Herausgeber Offenbach das Wort erteilt, folgt der Beginn von dessen Antwort auf die Kritiker (auch die kommenden) seines Barkouf.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das Programmbuch zu Barkouf an der Oper Zürich, Premiere am 23. Okrober 2022. Für diese Website wurden Zwischenzeilen und Illustrationen ergänzt. Eine weitere Fassung für das Magazin der Oper Zürich ist online zu lesen.