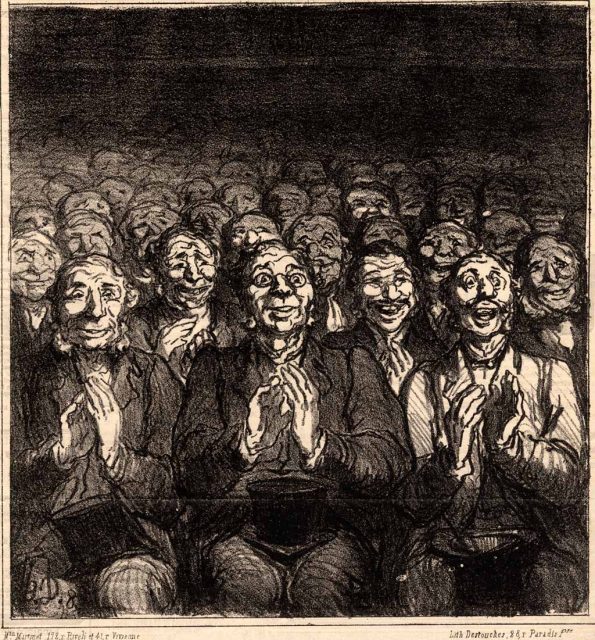Schon früh war Rebecca Saunders fasziniert vom “Ulysses” des James Joyce. Jetzt hat sie Töne für das berühmte Finale gefunden. Eine Begegnung mit der Komponistin in Berlin
Das hätte Molly Bloom, 34, wohnhaft in der Eccles Street 7 in Dublin, wohl nicht gedacht, dass sie mal so viel Zeit in Berlin zubringen würde – gut ein Jahrhundert nach ihrer berühmten Juninacht anno 1904. Auch wenn sie sich vieles gedacht hat in ihrem hemmungslosen Monolog am Ende des Ulysses von James Joyce, eben dem Text, der die Komponistin Rebecca Saunders seit ihrer Jugend fasziniert. Die blickt jetzt aus ihrem Arbeitszimmer auf die Bäume einer stillen Straße im Prenzlauer Berg und auf die Noten, in denen Molly eine, nein, viele Stimmen bekommt. Und in denen sie selbst, die Komponistin, sich erstmals seit frühester Zeit wieder an die wirklich singende Stimme gewagt hat. „Das war ein sehr langer Weg. Naja, wie lange schreib´ ich schon?“ Sie lacht.
Nein, die Sopranistin in Yes wird keine Arie singen, das sei gleich mal festgestellt, und auch keine sonstwie narrativen Linien. „Einen Text zu vertonen, das finde ich nicht interessant, nicht zeitgenössisch.“ Das würde auch keiner erwarten, der auch nur zwei Takte von Rebecca Saunders gehört hat, einer sehr gefragten Komponistin unserer Zeit. Die 49-jährige ist bekannt für superfein ausgesponnene und durchsonnene Klänge, klingende Flächen und Skulpturen sich wandelnder Farben, statisch oft und der Zeit enthoben. Sänger hat sie erst zweimal eingesetzt in 56 Werken, wobei das, was man gemeinhin Gesang nennt, nicht zu vernehmen war. Das ist diesmal ein klein bisschen anders. Wie so manches in ihrem neuen, einstündigen Stück.
Yes wird am 9. September bei den Berliner Festspielen uraufgeführt, eine räumliche Performance für Sopran und 19 Instrumentalisten nebst Dirigent, maßgeschneidert für den Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Dessen Grundriss liegt, vielfach kopiert, auf Saunders´ großem Schreibtisch am Fenster, bunt markiert mit den wechselnden Positionen der Leute vom Kölner Ensemble Musikfabrik. Holzbläser, Blechbläser, Streicher, zwei Schlagzeuger, zwei Pianisten, ein Akkordeon, dirigiert vom Komponisten Enno Poppe. Und natürlich der Sopranistin Donatienne Michel-Dansac. Die Musiker sind nicht nur im Raum verteilt, sie wandern auch herum. „Räumliche und zeitliche Polyphonie“ nennt Saunders das. Die Hörer sitzen mitten im Stück, mitten in den Klängen.
Vielleicht ist das Umgebensein von Klang auch ein Echo der Londoner Tage in den 1970ern, als Rebecca gern unter einem der Flügel lag, an denen ihre Eltern spielten, beide Pianisten, wie auch die Großeltern. „Es gab auch immer Sänger zuhause. Ich hab´ die nicht unangenehm gefunden.“ Und immer schrieb sie Lieder, als Kind schon. Mit 16 vertonte sie Blake, Plath und Woolf, „es war so selbstverständlich und natürlich, Melodie zu schreiben.“ Eben das, womit sie dann radikal brach. Da entwickelte sich „die absolute Abneigung, auch nur ein melodisches Fragment zu schreiben.“ Aber was dann? Im konservativen Großbritannien gab es wenig Neues zu hören. Ein Professor in Edinburgh, wo sie Komposition studierte, beschaffte Kassetten mit jüngster Avantgarde.
„Das war ein kompletter Schock! Ich war wie wachgerufen. Was, das gibt´s? Ein Klang, der nur für sich da steht, der sich auf nichts bezieht als auf seine eigene Körperlichkeit!“ Es war eine der Chiffren des Komponisten Wolfgang Rihm, die sie umgehauen hatte. „Da muss ich hin“, habe sie gedacht, bei dem wollte sie lernen. Mit einem Stipendium kam die 24jährige nach Karlsruhe, „ohne Prüfung, halb illegal, es war alles viel lockerer“, sagt sie. „Ich wollte noch mal von vorn anfangen.“ Es war in jeder Hinsicht ein Neustart. „Wenn man sich in eine fremde kulturelle Situation begibt, hat man die einmalige Chance, sich aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.“ Saunders spricht erlesenes Deutsch, mit kleinen britischen Modifikationen, das war damals anders.
„Ich konnte kein Wort Deutsch und er konnte nur wenig Englisch. Er hat einfache Fragen gestellt, über die ich tagelang nachdenken musste. Er hat gefragt, welches Gesicht hat dein Stück? Hat es Augen? Ich dachte, wow, es könnte keine Augen haben. Hat es einen Mund? Nein. Welche Farbe? Rot. Wo ist es denn? Das war für mich ein Geschenk. Nicht über die Musik zu sprechen, sondern sich schon in der Musik zu befinden.“ Einmal begann sie mit einem Stück für Streichorchester und brachte ihrem Professor ein großes Blatt voller Noten mit. „Er hat es langsam gedreht, falschrum, und gesagt: Bring mir einen Ton.“ Nur einen. Ein A, beschloss sie, am Klavier, in verschiedenen Farben. „Aber ohne Innenklavier“, lautete Rihms Bedingung – also ohne Tricks mit präparierten Saiten, Alufolie und Klöppeln. Nur Tasten und Pedal.
Da entdeckte sie, wie schon der Hintergrund, der Rahmen, die Perspektive einen Ton ändern kann. „Ein roter Punkt auf einem Bild wirkt unterschiedlich je nach Größe, Tiefe und Farbe des Hintergrunds.“ Von da ging es zum ersten Werk, das Rebecca Saunders von sich gelten lässt, Behind the Velvet Curtain, einem Rausch leuchtender Farben für Trompete, Harfe, Klavier und Cello, in dem sie auch die „lebensbejahende tolle Energie“ Wolfgang Rihms gespiegelt sieht. Beim zweiten Stück habe sie schon versucht, die Energielinien zu brechen und Bilder nebeneinanderzustellen, in denen „extrem hohe Energie“ herrscht, die zugleich ein Ganzes bilden. Eine Technik, die man ihrem Arbeitszimmer auch jetzt ansieht. Die Wände sind reihenweise gepflastert mit Notenblättern, „Modulen“, aus denen der Monolog auf die Sekunde genau collagiert wird.
So kontrolliert und planvoll, wie sie notiert ist, klingt Rebecca Saunders´ Musik gerade nicht. Man kann sich verlieren in den weiten Flächen von Stirrings Still, in deren Holzbläsergewebe und Zimbelschimmern mitunter ein Klavierton eingesenkt ist wie ein kleiner Stein. Man kann sich in Vermilion erschrecken vor der Vollbremsung einer E-Gitarre, im Halbtonschritt einer Klarinette ein ganzes Gedicht ahnen. Man hört im Violinkonzert Still, wie eine unberechenbare, wütend kratzende Geige aus der Stille hervorbricht und Reaktionen des Orchesters wachruft, am Ende aber in weiten Linien über einem ruhig wogenden Meer von Klangschichtungen kreist, dem titelgebenden Text von Samuel Beckett entsprechend: „Lass es so alles ziemlich still oder versuch all den Klängen zu lauschen alle ziemlich still den Kopf in den Händen…“
Bei Beckett fühlt sich die Komponistin am tiefsten verstanden. „Ich habe nichts zu sagen, aber ich will damit alles sagen. Ich finde es fast arrogant, irgendeine Botschaft durch die Musik weitergeben zu wollen.“ Eben darum werden Worte von ihr nicht vertont und gedeutet, sondern als musikalisches Material verwendet – was auf ihre Weise ja auch Beckett und Joyce tun. Es ist der Klangreichtum der endlosen Sätze, der Mollys schamfreien, von Leben und Intimitäten überquellenden Monolog im Ehebett bis hin zum „I said yes I will Yes“ zur großen Prosa vom Menschsein macht. Gut die Hälfte der Wörter hat Saunders gewählt und auf die Mitwirkenden verteilt, es werden Silben in die Bassflöte geflüstert und geschrien, der Akkordeonist spricht, während sein Instrument einatmet, die Sängerin sogar dann, wenn sie keinen Atem mehr hat.
Dabei geht es nicht um diffizile Experimente, sondern um das „Urmenschliche“, wie die Komponistin es nennt – um die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit jedes Einzelnen. Und da berührt sich die Musik vielleicht mit einer Gegenwart, die Rebecca Saunders als „gefährlich, fragil, unstabil“ erlebt. „Es kann gut sein, dass wir die verwöhnteste Generation jemals waren und den Höhepunkt der westeuropäischen Zivilisation erlebt haben. Alles wurde vor uns erkämpft. Wir haben so viele Jahrzehnte in einer Art Schlaf gelebt, in einer manisch selbstbezogenen Existenz.“ Wobei freilich die Kunst geblüht habe: „Man kann schreiben, was man schreiben muss, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Da kann Wunderbares entstehen. Aber wir müssen jetzt alles neu erkämpfen.“
Im Prenzlauer Berg scheint sie fern, die unstabile Welt. Rebecca Saunders lebt mit ihren beiden Kindern in einem der letzten vermieteten Häuser hier, „die andern gehören alle den Schwaben“, sagt sie lachend. Sie hat zwanzig Jahre lang zugeschaut, wie aus dem maroden Viertel eine poshe Gegend wurde, wie Künstler ihre Ateliers verloren. Und sie hat gewartet, dass endlich das Urheberrecht für Ulysses erlischt – vor 2015 durfte sie Mollys Monolog gar nicht verwenden. Und sie hat sich nach und nach an die Stimme herangetastet. Ihre Sopranistin wird oft nur flüsternd, gebremst, wie unter der Oberfläche ihre Stimme einsetzen, wie in Skin, einem Stück auf dem Weg zu Yes. Aber diesmal wird die Solistin auch wahrhaftig singen. „Sehr klare melodische Fragmente. Es ist das erste Mal, dass ich eine Akteurin zur Welt gebracht habe. Es ist zutiefst persönlich“, sagt Rebecca Saunders und blickt fast erstaunt auf das Blatt.
Dieser Text erschien in der ZEIT vom 7. September 2017 und ist urheberrechtlich geschützt